Cargobikes eignen sich im Stadtverkehr prima als Autoersatz zum Transport von Lasten. Erste Städte und Kommunen testen das Sharing der Schwertransporter. Die Niederländer sind bereits einige Schritte weiter. (erschienen in VELOPLAN, Nr. 02/2023, Juni 2023)
160 elektrische Sharing-Cargobikes stehen zurzeit in den Straßen von Den Haag. Kommerzielle Anbieter wie Cargoroo und BAQME haben sie dort aufgestellt. Die Stadtregierung findet das gut. Sie will die Zahl der Räder bis 2027 sogar auf 1500 steigern. „Unser Ziel ist, in jeder Straße von Den Haag ein Cargobike aufzustellen“, sagt Rinse Gorter, zuständig für Sharing-Mobility in der Gemeinde. Die geteilten Lastenräder sollen es den 550.000 Einwohner*innen leichter machen, auf Autofahrten im Zentrum zu verzichten und die Emissionen zu senken.
Auch in deutschen Großstädten gehören Cargobikes längst zum Stadtbild. Hierzulande sind die Menschen aber vor allem auf eigenen Rädern unterwegs. Die Verkaufszahlen zeigen: Die Transporträder sind beliebt. Im vergangenen Jahr verzeichnete die Sparte Cargobike mit 37,5 Prozent das größte Wachstum in der Fahrradbranche. 212.800 Lastenräder wurden insgesamt verkauft, 165.000 von ihnen hatten einen Motor. Allerdings ist es mit den Transporträdern ähnlich wie mit den Autos: Die meiste Zeit des Tages stehen sie ungenutzt herum. Für Verkehrsforscher ist Sharing deshalb eine sinnvolle Alternative. In Berlin, Düsseldorf, Hamburg oder auch Freiburg haben die Stadtregierungen und kommerzielle Anbieter erste Flotten auf die Straßen gestellt. Allerdings sind die oft zu klein, um Autofahrten im großen Stil zu ersetzen.
Eine Ausnahme ist Berlin. Dort versucht der niederländische Sharing-Anbieter Cargoroo seit 2022 ein engmaschiges Netz aus geteilten E-Cargobikes aufzubauen. Aktuell sind 250 Cargoroos mit den auffälligen gelben Transportwannen in der Hauptstadt unterwegs. Bis zum Sommer soll die Flotte auf 350 wachsen, damit die Nutzenden an ihrem Wohnort idealerweise alle 300 Meter ein Cargoroo finden. Die Leihräder stehen an festen Stationen. Das heißt: Die Räder können nur dort ausgeliehen und zurückgegeben werden. „Das gibt unseren Kundinnen und Kunden Planungssicherheit“, sagt Alexander Czeh, Country Manager von Cargoroo Deutschland.
Außerdem bevorzugen die Bezirksregierungen in Berlin das stationsbasierte Sharing-System. Sie wollen damit die Gehwege von Sharing-Fahrzeugen freihalten. Die Cargoroo-Stationen werden in Berlin nur auf breiten Gehwegen markiert, die ausreichend Platz zum Rangieren bieten. Ansonsten werden sie auf umgewandelten Pkw-Stellplätzen eingerichtet oder an einer Jelbi-Mobilitätsstation der Berliner Verkehrsbetriebe. Nur dort kann die Ausleihe per App beendet werden.
Das stationsbasierte Modell lohnt sich auch für die Sharing-Anbieter. Die Service-Mitarbeiter müssen die Räder nicht einsammeln. Sie checken die Räder zweimal pro Woche an ihrem Standort und wechseln dann die beiden Akkus. Das senkt die Kosten. Auch die Nutzenden haben laut Czeh keine Nachteile. Schließlich sind 80 Prozent Lastenradfahrten Rundfahrten. Wer zum Discounter fährt oder zum Baumarkt, bringt seine Einkäufe anschließend heim.
Cargoroo wirbt damit, dass ihre E-Lastenräder die Verkehrswende vorantreiben. In den Niederlanden teilen sich laut Alexander Czeh rechnerisch zwischen 40 und 60 Kunden ein Cargoroo. „Eine Umfrage unter ihren Nutzerinnen und Nutzern aus Amsterdam zeigt zudem, dass 73 Prozent von ihnen mit unseren Rädern Autofahrten ersetzen“, sagt Czeh. Im kommenden Jahr rechnet er mit ähnlichen Werten für Berlin. „Dann können unsere 350 Räder 625.000 Autokilometer im Jahr ersetzen“, sagt er, und damit rund 100 Tonnen Kohlendioxid einsparen. Damit würde die Cargoroo-Flotte einen wichtigen Beitrag zur Mobilitätswende leisten.


Fahrradkeller 2.0: Die Mobilitätsstation für Lastenräder, Fahrradanhänger und Trolleys ist hell, sicher und komfortabel im Erdgeschoss des Mietshauses untergebracht.
Städte brauchen autoärmere Innenstädte
Die Klimaziele zwingen viele Städte und Gemeinden, den Verkehr in ihren Zentren nachhaltiger zu gestalten. Die bayerische Landeshauptstadt München will bis 2035 klimaneutral werden. Deshalb fördert das städtische Mobilitätsreferat klimafreundliche Alternativen zum Auto. Beim Neubau von Wohnungen können die Bauherren Stellplätze einsparen, indem sie Mobilitätskonzepte einreichen. Damit senken sie die Baukosten und ermöglichen ihren Mietern eine autoarme Mobilität.
Ein Vorreiter auf diesem Gebiet ist die städtische Wohnungsgesellschaft GWG in München. Sie hat bereits an vier Neubau-Standorten Mobilitätsstationen errichtet. Neben Autos, E-Bikes, Trolleys und Fahrradanhängern bietet die GWG auch E-Lastenräder an. Der Clou ist: Die Ausleihe der E-Cargobikes ist kostenlos. Die Mieter müssen lediglich einen Chip beantragen. Untergebracht sind die Räder in hellen Räumen mit Fenstern im Erdgeschoss der Mehrfamilienhäuser. Per Chip schwingt die Tür automatisch auf. Das macht den Fahrer*innen das Rangieren mit den Transporträdern leicht und komfortabel.
Obwohl die Hemmschwelle für die Cargobike-Ausleihe bei der GWG niedrig ist, ist ihre Nutzung kein Selbstläufer. Am Eröffnungstag der beiden Mobilitätsstation in Hardthof im Norden von München ist Steffen Knapp, Architekt und zuständig für die Projektentwicklung im Team Städtebau der GWG, zwei Stunden von Tür zu Tür gegangen und hat die Mieter über das Angebot informiert. „Ich habe sie eingeladen, die Lastenräder vor der Haustür auszuprobieren“, sagt er. Er weiß, die Probefahrt ist wichtig. Die meisten GWG-Mieter saßen noch nie auf einem Lastenrad. Sie brauchen eine Einführung und Unterstützung bei der Probefahrt. Knopps Engagement zahlt sich aus. Rund 40 Prozent der Mieterschaft hat sich fürs Sharing-Angebot registriert. Die E-Cargobikes sind laut Knopp die „Hotrunner“ im Sharing-Angebot. Sie werden am häufigsten ausgeliehen. Bis 2026 plant die GWG, rund 30 weitere Mobilitätsstationen in ihren Wohnprojekten zu etablieren.
40 bis 60
Kunden teilen sich ein
Cargoroo in Amsterdam
70 Lastenräder für Hamburg
Erste Städte beginnen, Cargobikes in das städtische Bike-Sharing-System zu integrieren. In Freiburg im Breisgau können die Kund*innen mittlerweile 20 E-Cargobikes über die städtischen Leihradflotte „Frelo“ ausleihen. In Hamburg bekam das „StadtRad“-Verleih-System bereits 2019 Zuwachs von 19 Cargobikes. Inzwischen ist ihre Zahl auf 37 gestiegen. Eigentlich sollte die Flotte längst 70 Transporträder umfassen, aber Lieferengpässe verzögern seit Monaten den Ausbau. In beiden Städten kommen die Lastenräder gut an. Laut dem Sprecher der Hamburger Verkehrsbehörde wurden sie 2022 rund 3700-mal ausgeliehen. „Im Mai lag der Spitzenwert bei 445 Ausleihen“, sagt er, im Schnitt waren die Nutzenden mit ihnen zwei Stunden unterwegs.
Das Angebot ist vielseitig an der Mobilitätsstation am Bachplätzchen. Neben E-Lastenrädern können die Anwohner*innen auch E-Autos oder E-Scooter leihen und eigene Fahrräder sicher parken.


Mehr Grün mit Mobilitätsstationen
Erste Städte wollen mit ihrem Lastenrad-Sharing-Angebot auch die Aufenthaltsqualität in den Zentren verbessern. In Düsseldorf sind die Transporträder beispielsweise in vielen Wohnquartieren ein Bestandteil der Mobilitätsstationen. Bis 2030 soll das Startup Connected Mobility Düsseldorf GmbH (CMD) im Auftrag der Stadt Düsseldorf 100 Mobilitätsstationen im Zentrum errichten. Damit werden für die Anwohnerinnen nachhaltige Mobilitätsangebote vor Ort geschaffen. Acht Stationen sind bereits fertig. Eine von ihnen ist das Bachplätzchen im Düsseldorfer Stadtteil Unterbilk. Früher parkten 30 Autos auf dem asphaltierten Oval. Im Dezember 2022 ist aus dem Parkplatz ein begrünter Treffpunkt geworden. Zwischen Bäumen und Pflanzen haben die Anwohnerinnen dort nun ausreichend Platz zum Verweilen und zum Boule spielen. Außerdem können sie auf einen Fahrzeug-Pool aus E-Autos, drei E-Lastenrädern, E-Scootern und E-Mopeds zugreifen.
„Platz ist Luxus im Stadtzentrum“, sagt Ariane Kersting, Sprecherin der CMD. Jede Mobilitätsstation soll deshalb auch das Umfeld aufwerten. Neben dem Fuhrpark werden stets neue Grünflächen geschaffen oder Sitzgelegenheiten. Je nachdem, wie viel Platz im Wohnquartier, der ÖPNV-Station oder bei den Unternehmen zur Verfügung steht.
Das neue Mobilitätsangebot in Düsseldorf gefällt den Anwohnern. „Kaum waren die ersten Stationen fertig, riefen uns die Bürger an, und meldeten ebenfalls Bedarf an“, sagt die CMD-Sprecherin. Aber auch hier braucht das Lastenrad-Sharing Starthilfe. „Wir organisieren immer wieder Aktionstage oder Veranstaltungen im Quartier, damit die Menschen Lastenräder ausprobieren können“, sagt sie. In Nutzervideos erklären sie außerdem auf den Social-Media-Kanälen wie die Ausleihe funktioniert und worauf beim Fahren mit Last und Motor zu achten ist.
Lastenrad-Sharing zu etablieren, ist für Ariane Kersting ein Dauerlauf und kein Sprint. „Die Menschen müssen die Chance bekommen, das Angebot in ihrem Alltag auszuprobieren und nach und nach zu integrieren“, sagt sie. Erst wenn ihnen der Zugriff auf die Alternative zum Auto gesichert und komfortabel erscheint, würden sie überhaupt darüber nachdenken, auf ihren Zweitwagen zu verzichten.
Die Integration der Lastenräder an Mobilitätsstationen oder in das städtische Leihrad-System hat für Carina Heinz vom Deutschen Institut für Urbanistik einen großen Vorteil: Es sorgt für mehr soziale Gerechtigkeit in der Mobilität. „Nicht jeder kann oder will 5000 bis 8000 Euro für ein elektrisches Lastenrad ausgeben“, sagt sie. Zwar fördern einige Städte und Bundesländer den Kauf von Lastenrädern über Zuschüsse, aber die Käufer müssen dennoch mehrere Tausend Euro bezahlen. Das ist viel, wenn man das Rad nur ein oder zweimal pro Woche nutzt. Deutlich wirkungsvoller ist aus ihrer Sicht die Förderung von Lastenrad-Sharing direkt über die Kommune. „Der Hebel ist größer. Die Gemeinde erreicht mit diesem Service in kürzerer Zeit eine viel größere Bevölkerungsgruppe“, sagt sie. Im Idealfall auch die Menschen, die sich selbst mit einem Zuschuss kein eigenes Lastenrad leisten können.
Der Schritt vom Besitz zum Teilen ist entscheidend für die Mobilitätswende. Die Anbieter der Sharing-Systeme am Wohnort sind die Wegbereiter des Wandels. Im direkten Vergleich mit vielen niederländischen Städten wie Den Haag steckt das Lastenrad-Sharing in Deutschland noch vielerorts in den Kinderschuhen. Jetzt sind die Städte und Gemeinden am Zug. Sie müssen in den Stadtzentren Millionen kurzer Autofahrten ersetzen, die kürzer sind als fünf Kilometer. Lastenrad-Sharing ist dabei nur ein Baustein von vielen. Aber einer mit großer Wirkung.
Bilder: Cargoroo, GWG München – Jonas Nefzger, CMD

 Cargoroo
Cargoroo


 Torsten Stapel
Torsten Stapel



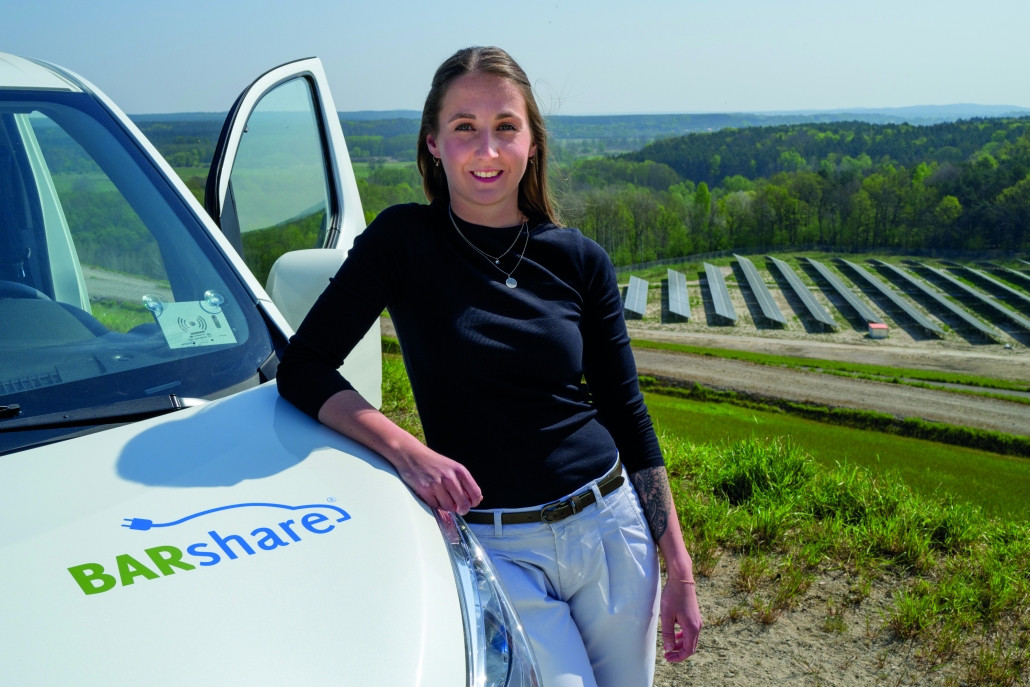
 Nextbike
Nextbike

