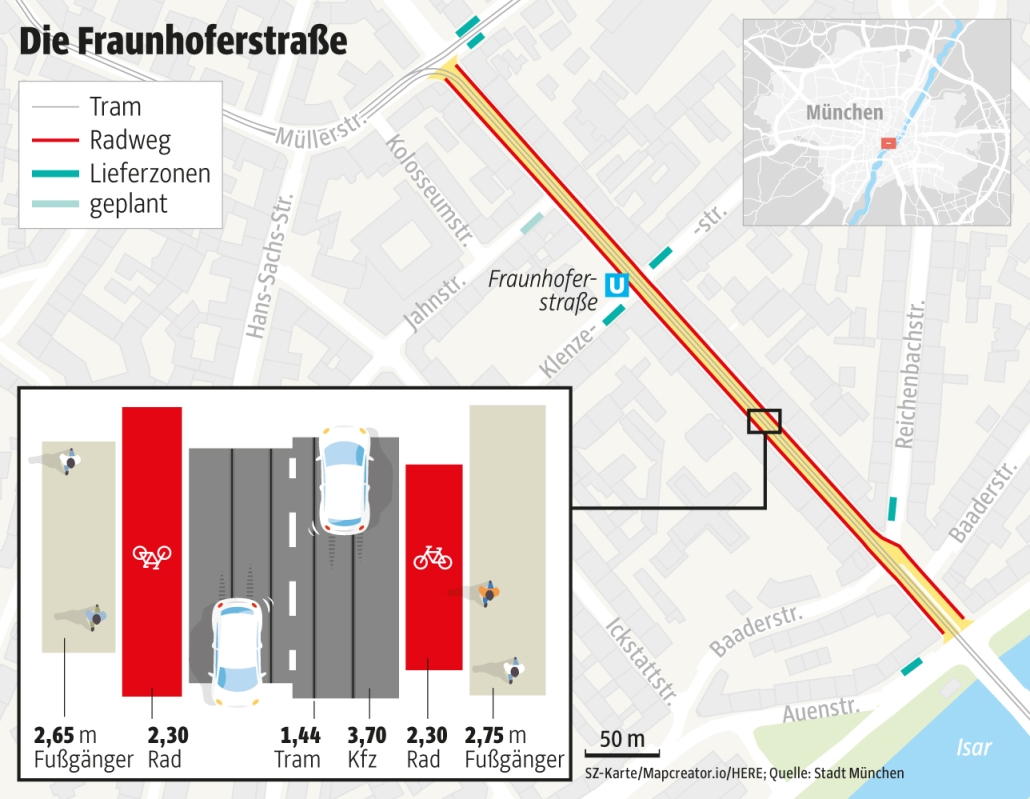Der Personalmangel in den Verwaltungen bremst vielerorts die Mobilitätswende. Zudem werden Aufgaben oft falsch verteilt. Flexible Lösungen und der Quereinstieg von Fachkräften können das Pro-blem schnell lösen. Doch diese Herangehensweise hat auch ihre Grenzen. (erschienen in VELOPLAN, Nr. 02/2022, Juni 2022)



Popup-Bikelanes wie in Berlin (links und oben rechts) oder in Stuttgart (rechts unten) wurden in den letzten zwei Jahren oft in Rekordzeit umgesetzt. Eine Voraussetzung dafür sind Teams im Hintergrund, die nicht nur mit Fach-, sondern auch mit weitreichender Entscheidungskompetenz ausgestattet sind.
Die Rahmenbedingungen für den Ausbau des Radverkehrs sind so gut wie nie. 1,4 Mrd. Euro hat die Bundesregierung für den zügigen Ausbau der Infrastruktur bereitgestellt. Aber in den Kommunen geht es dennoch vielerorts nur schleppend voran. Ein Hemmschuh ist der Fachkräftemangel. Jahrelang wurden zu wenigRadverkehrsplaner und -planerinnen ausgebildet. Jetzt fehlen diese Fachkräfte. Ein Umdenken in der Stellenbesetzung und eine breitere Aufgabenteilung in der Verwaltung könnten dabei helfen, schneller ans Ziel zu kommen.
Einen Grund für den Personalmangel sehen Expertinnen in dem engen Fokus der Jobausschreibungen. Stellen für Planer- und Projektleiterinnen werden in der Regel mit Verkehrs- oder Bauingenieurinnen besetzt. Zu einseitig, findet etwa der Verwaltungssoziologe Peter Broytman. Er arbeitete dreieinhalb Jahre als Radverkehrskoordinator in der Berliner Verkehrsverwaltung und ist jetzt in der Sozialverwaltung des Senates und als Berater tätig. Er sagt: „Wir müssen die Städte umbauen, nicht nur den Verkehr. Das ist eine innovative Aufgabe, die vielfältige Fähigkeiten wie Change-Management erfordert und nicht nur das millimetergenaue Zeichnen von Plänen.“ Broytman weiß, wovon er spricht. Er hat als Mitgründer den Volksentscheid Fahrrad und dann das Berliner Mobilitätsgesetz auf den Weg gebracht. Nicht allein, sondern im Team. Jetzt muss der Richtungswechsel in der Verkehrspolitik pro Bus-, Bahn-, Rad- und Fußverkehr in die Verwaltung getragen und umgesetzt werden. Deshalb sollten die Projekt-leiterinnen dieser Teams aus seiner Sicht vorrangig Projektmanagement beherrschen, gut kommunizieren können und netzwerken. „Das sind ganz klassisch die Aufgaben eines Referenten“, sagt Broytman. Ein Verkehrsingenieur, der sich auf so eine Projektleiterstelle bewerbe, werde keinen Plan zeichnen. Diese Erkenntnis habe sich allerdings noch nicht durchgesetzt. Die Kommunen suchten für diese Stellen bundesweit in erster Linie nach Ingenieurinnen. Das reduziere die Zahl der Fachkräfte, die für den Job infrage kommen, und zudem fehlten dann die Ingenieurinnen in den Planungsabteilungen.

„Wir müssen die Städte umbauen nicht nur den Verkehr“
Peter Broytman, Senatsverwaltung Berlin
Mehr Vielfalt im Team kann aus seiner Sicht auch den Ausbau der Radinfrastruktur beschleunigen – sowohl auf der Projektebene wie im Team der Radverkehrsplaner- und planerinnen. In Berlin verbringen laut Broytman die Radverkehrsplanerin-nen etwa 70 Prozent ihrer Zeit mit Organisation und Kommunikation. Sie bearbeiten Anfragen der Bürger und Bürgerinnen, planen Beteiligungsverfahren und akquirieren Räume für die Versammlungen. „Das frisst pro Kilometer Radweg unglaubliche Ressourcen“, sagt er. Damit sich die Planerinnen auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren können, sollten die Aufgaben spezifischer verteilt werden.
„Gerade in der ersten Planungsphase ist das mit Quereinsteigern gut möglich“, sagt Thomas Stein, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Mobilität am Deutschen Institut für Urbanistik. In diesem Stadium geht es um die Grundlagen. Erste Konzepte und Ideen werden entwickelt, die dann mit der Politik und den verschiedenen Behörden, Verbänden und Trägern öffentlicher Belange abgestimmt werden. Im nächsten Schritt starten dann die ersten Beteiligungsverfahren. „In diesem Stadium ist es hilfreich, Menschen im Team zu haben, die mit ihrer Qualifikation breiter aufgestellt sind und andere Standpunkte einnehmen können“, sagt Stein. Dazu gehören Kommunikationsexpertinnen oder auch Sozialwissenschaftlerinnen.
Die Stadt Heidelberg hat das früh erkannt. „Dort gibt es eine eigene Abteilung, die sich ausschließlich um Beteiligungsverfahren kümmert“, sagt Stein. Deren Mitarbeitenden unterstützen mit ihrem Know-how die Verkehrsingenieurinnen bei jeder Planung für den Rad- und Fußverkehr. Für Stein ist das eine gute Lösung. „Beteiligungsverfahren sind inzwischen ein zentraler Baustein jeder Verkehrsplanung“, sagt er. Sind sie passgenau auf die Belange der Teilnehmenden zugeschnitten, sei die Zustimmung am Ende meist groß. Im besten Fall beschleunigen sie den Ausbau der Radinfrastruktur. Ein erweiterter Expertenkreis kann demnach den Fachkräftemangel bei den Verkehrsingenieurinnen etwas abpuffern. Allerdings nur in der Anfangsphase. Je weiter die Planung voranschreitet, umso technischer werden die Entscheidungen. „Beim Schotter hört der Quereinstieg bei der Verkehrswende auf“, sagt Stein. Die Pläne müssen millimetergenau gezeichnet werden.
Mitarbeiter*innen müssen ihre Rolle verstehen
Mehr Planer und Planerinnen werden dringend benötigt. Aber neben ausreichend Personal muss auch das Zusammenspiel zwischen Politik und Verwaltung stimmen. Dazu gehört, dass jeder seine Rolle genau kennt und seine Befugnisse nutzt. Wie das im Idealfall aussieht, macht der Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg vor. Dort traf der Wille zur Mobilitätswende auf eine handlungsfreudige Verwaltung. Die Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann brachte im Frühjahr 2020 mit dem Leiter des Straßen- und Grünflächenamts, Felix Weisbrich, den ersten Popup-Radweg Deutschlands auf die Straße. Die Entscheidung war mutig. Das rechtliche Okay hatten sie sich zuvor bei Christian Haegele aus der Senatsverwaltung geholt. Der Verwaltungsfachwirt leitet dort die Abteilung Verkehrsmanagement und kennt die Spielräume genau, die ihm die Straßenverkehrsordnung (StVO) und das Straßenrecht bieten.
Der ersten Popup-Bikelane folgten weitere provisorische Lösungen. Etwa im April 2020 auf dem Kottbusser Damm. Auf einer Länge von 1,8 Kilometer wurde eine Fahrspur mithilfe von gelbem Klebeband und Baustellenbaken zum Radweg. Ein Jahr später war die Strecke sauber markiert und teilweise abgepollert – und so in einen geschützten Radstreifen umgewandelt. Für Berlin ist das eine Rekordzeit. Auf diese Weise schaffte der Bezirk so viele neue Radkilometer wie kein anderer in der Stadt. Dem rbb24 erklärte Weisbrich sein Beschleunigungsverfahren im Frühjahr 2022 so: „Wir haben es geschafft, kleinste Teams zu bilden, mit einer wirklich weitreichenden Entscheidungskompetenz. Wir müssen also nicht ständig von Pontius zu Pilatus laufen, sondern bekommen per Telefon und Mail schnelle Rückmeldungen von den Senatsverwaltungen und anderen Beteiligten – man muss nicht immer Akten hin und her schicken, das dauert viel zu lange.“ Broytman dazu: „So bringt man die Mobilitätswende auf die Straße. Die Experten haben ihre Rolle verstanden, die Planung gemacht und gesagt: Wir ziehen das jetzt durch.“
„Gerade in der ersten Planungsphase ist ein Quereinstieg gut möglich.“
Thomas Stein,Deutsches Institut für Urbanistik
Engpässe in der Verwaltung gibt es auch in den Niederlanden. Dort wird dieses Problem jedoch mitunter flexibler gelöst, indem Fachkräfte für die Planung zeitweise von Beraterfirmen zugekauft werden.
Planung umsetzen, Gegenwind aushalten
„Dazu gehört auch, dass eine einmal beschlossene Planung umgesetzt wird und Politik und Verwaltung gegebenenfalls auch den Gegenwind aushalten“, sagt der Difu-Experte Stein. Das ist nicht selbstverständlich. „Ich habe mit Verkehrsplanerinnen in Verwaltungen gesprochen, die bereits verschiedene Radverkehrskonzepte erstellt haben, von denen keines umgesetzt wurde, weil der politische Rückhalt fehlte“, sagt der niederländische Mobilitätsexperte Bernhard Ensink vom Beratungsunternehmen Mobycon. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sei das frustrierend. Wenn sie bei der Umsetzung der Radverkehrsplanung immer wieder ausgebremst werden, schwinde die Motivation und die Bereitschaft, mutiger zu planen. „Engpässe bei Radverkehrspla-nerinnen gibt es auch in den Niederlanden“, sagt Ensink. Allerdings gingen die Kommunen damit flexibler um als in Deutschland. „Die Expertise für die Planung kann man sich auch einkaufen“, sagt er. Etwa über Rahmenverträge. Das sei in den Niederlanden inzwischen üblich. Beraterfirmen wie Mobycon beispielsweise vermieteten Fachkräfte an niederländische Verwaltungen über die eigens dazu gegründete Firma Mobypeople.
Allerdings ist für ihn der Fachkräftemangel in Deutschland viel inte-graler als in den Niederlanden. „Es geht nicht allein um die technische Zeichnung, also um die Planung des Radwegs“, sagt er. Die Prozesse seien viel einschneidender. Eine gute Radverkehrsplanung verändere stets das Mobilitätsverhalten aller Verkehrsteilnehmer, also auch der Autofahrer, sagt Ensink. Das solle immer mitgedacht werden.
„Engpässe bei Radverkehrsplaner*innen gibt es auch in den Niederlanden.“
Bernhard Ensink, Mobycon
Bei der Radverkehrsplanung überlassen die Niederländer nichts dem Zufall. Ob man das Auto oder das Rad nimmt und wie schnell man fährt, ist hauptsächlich eine Frage der Psychologie. Das zeigt sich beim Wechsel von einer Hauptverkehrsstraße in eine Seitenstraße. Er sollte für alle Verkehrsteilnehmerinnen haptisch spürbar sein. Um das sicherzustellen, ändert sich in den Niederlanden der Straßenbelag, sobald von einer Hauptstraße in eine Tempo-30-Zone oder eine Wohnstraße gewechselt wird. Statt glattem Asphalt sind hier Pflastersteine verlegt. Beim Abbiegen verändert sich sofort das Fahrgefühl, die Rollgeräusche nehmen deutlich zu. Um die Geschwindigkeit konsequent zu verringern, verjüngen die Planerinnen zudem die Fahrbahn in den Wohngebieten mit Bäumen oder Grünbepflanzungen, und reduzieren die Geschwindigkeit weiter auf 15 bis 20 km/h.
Diese technischen und psychologischen Elemente nutzen die Niederländer auch, wenn sie Fahrradstraßen nachträglich einrichten. „Das Aufpflastern ist dann zwar kostspielig, aber es lohnt sich“, sagt Ensink. Der Hinweis an die Autofahrerinnen sei deutlich: Ihr seid hier nur zu Gast. In Deutschland werde das schnell übersehen, wenn nur das blau-weiße Verkehrszeichen die Fahrradstraße anzeige. Diese psychologische Alltagserfahrung beim Radfahren prägen niederländische Planer. Deutschen Ver-kehrsplanerinnen, die vielleicht immer nur Autostraßen geplant haben und dann mit der Planung von Radwegen beauftragt werden, fehle dafür oftmals die Alltagserfahrung der niederländischen Kollegen. „Deutschland braucht nicht nur Ingenieure, sondern auch Transformateure“, sagt Ensink, Experten, die Veränderungsprozesse steuern könnten. Und zwar während des gesamten Prozessverlaufs. Denn je näher die Realisierung der Pläne auf der Straße rücke, umso größer werden die Einwände und Bedenken verschiedener Stakeholder, sagt Ensink. Immer wieder rückten dann die eigentlichen Ziele des Umbaus in den Hintergrund, etwa der Klimaschutz. Deshalb sei es wichtig, Leute im Team zu haben, die den Transformationsprozess stets mitdenken und während der gesamten Planungsphase im Auge behalten und ihn auch einfordern.
Die Aufgaben, die vor den Verkehrsteams liegen, sind riesig. Sie müssen die Straßen neu gestalten und den Menschen vor Ort die Mobilitätswende schmackhaft machen. Das erfordert verschiedenste Fähigkeiten und diverse Teams, die gut kommunizieren, stabile Netzwerke aufbauen und gut planen müssen. Die Mobilitätswende findet nicht nur auf der Straße statt. Sie verändert auch die Strukturen in der Verwaltung. Sie erfordert von den Kommunen, Prozesse neu zu denken und mehr Flexibilität bei der Planung und bei der Rekrutierung des Personals. Dieser Transformationsprozess hat begonnen. Jetzt gilt es, das Tempo zu steigern.
Bilder: stock.adobe.com – mhp, qimby.net – Alexander Czeh, qimby.net – Peter Broytman, qimby.net – Benedikt Glitz, changincities, qimby.net – Martin Randelhoff, qimby.net – Philipp Böhme

 stock.adobe.com – mhp
stock.adobe.com – mhp

 stock.adobe.com – Kara
stock.adobe.com – Kara




 Clear Channel
Clear Channel









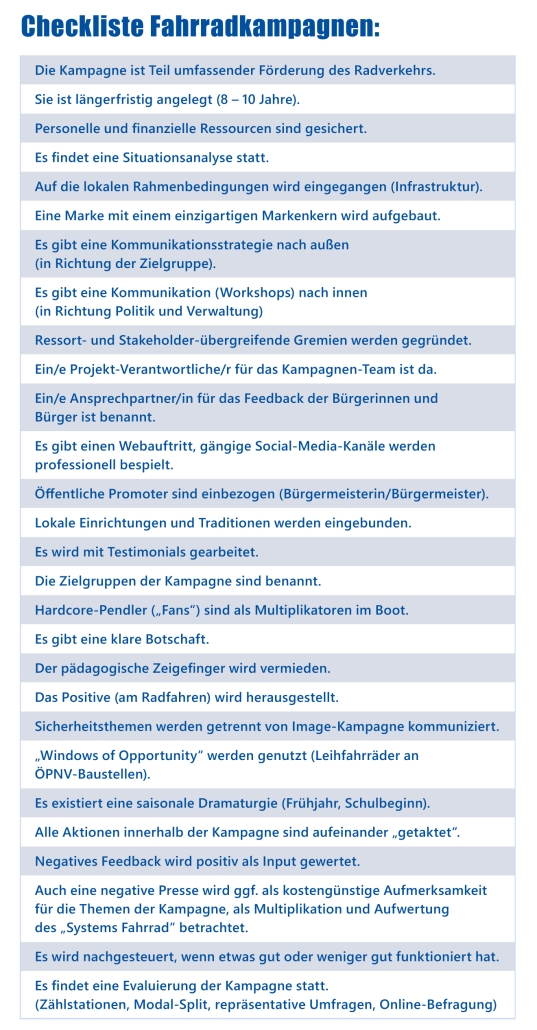

 Velokonzept
Velokonzept
 Micromobility Expo
Micromobility Expo



 Fachhochschule Erfurt (FHE) – Institut Verkehr und Raum
Fachhochschule Erfurt (FHE) – Institut Verkehr und Raum





 Stefan Kuhn Photography
Stefan Kuhn Photography

 stock.adobe.com – Achim Wagner
stock.adobe.com – Achim Wagner Stephan Rumpf
Stephan Rumpf