Kleine Outdoor-Abenteuer als erholsame Fluchten vom Alltag liegen im Trend. Und das Thema Bikepacking schickt sich an, aus dem Nischendasein auf die große Bühne zu treten. Gunnar Fehlau, Fahrradexperte, Buchautor und nicht zuletzt begeisterter Anhänger dieser neuen Form des sportlichen Radtourismus abseits üblicher Routen erläutert die Hintergründe und Chancen für den Tourismus. (erschienen in VELOPLAN, Nr. 03/2020, September 2020)
„Backpacking“ bezeichnet im englischen Sprachraum Rucksackreisen. Diese erfolgen keinesfalls aus „Geldmangel“, sondern sind in der Regel eine bewusste Entscheidung. Das Reisen mit dem Rucksack bringt einen in Regionen, die ansonsten nur schwer zugänglich sind. Man ist nahe an Land und Leuten und man erlebt sich selbst bei der direkten Interaktion mit Witterung und Topografie sehr intensiv. Unter anderem in Gestalt des modernen Pilgers ist dies auch in Europa in den vergangenen Jahren populär geworden. Das Bikepacking überträgt diese Idee aufs Fahrradfahren: mit leichtem Gepäck durch mitunter schweres Gelände Touren fahren.
Nordamerika mit extremer Mountainbike-Route Vorreiter
Ausgangspunkt des Bikepacking-Trends ist die „Great Divide Mountain Bike Route“ – die längste Mountainbike-Reiseroute der Welt. 1996 publizierte Michael McCoy für die Adventure Cycling Association diese Route als Kartenset. Sie führt vom kanadischen Banff/Alberta die US-kanadische Grenze und die amerikanische Wasserscheide entlang über die Rocky Mountains bis nach New Mexiko. Die in vielerlei Hinsicht extreme Tour ist 4.418 Kilometer lang und ihre Anstiege summieren sich auf 61.000 Höhenmeter. Macher Michael McCoy sieht über 50 (Tages-)Etappen vor. Montainbike-Sportler John Stamstad legte sie im Sommer 1999 im „Wettkampfmodus“ binnen 18 Tagen, 5 Stunden und 37 Minuten zurück. Weil die Strecke Passagen von bis zu 160 Meilen (ca. 257 km) ohne Versorgungsmöglichkeiten umfasst, packte Stamstad eine leichte Campingausrüstung ein und sorgte für genügend Platz, um ausreichend Lebensmittel verstauen zu können. Aus der Not, nur wenige Versorgungsmöglichkeiten zu haben, wurde eine Tugend: Das Prinzip Selbstversorgung (Self Support Racing), das jede Art privater Unterstützung verbietet, war geboren. 2010 erschien der Film „Ride the Divide“, der das Rennen entlang der Wasserscheide international bekannt machte und für einen weltweiten Boom sorgte. Mittlerweile gibt es einen reichlich gefüllten Veranstaltungskalender mit Bikepacking-Fahrten unterschiedlicher Längen und Schwierigkeitsgrade auf der ganzen Welt.


Bikepacking ist bestens geeignet, um mit Kindern in der Natur unterwegs zu sein. Auch toll: ein gemütlicher Lagerplatz mit Blick auf die Lichter der abendlichen Stadt. So macht Bikepacking Spaß – entsprechende Rahmenbedingungen vorausgesetzt.
Neue Produkte fördern den Trend
Die Ausrüstung für solche Fahrten, aber auch kleinere Abenteuer, hat sich inzwischen vom herkömmlichen Mountainbike- und Packtaschensortiment emanzipiert. Fahrradhersteller wie die US-Marke Salsa oder der deutsche Hersteller Bombtrack setzen voll aufs Thema „Adventure by Bike“ mit Rädern, die spezifisch fürs Bikepacking optimiert sind. Sie bieten Komfort und Zuladung, ohne die Sportlichkeit und das Tempo aus den Augen zu verlieren. Wichtigstes Merkmal der Ausrüstung sind die speziellen Taschen, die ohne ausladende Gepäckträger direkt am Rahmen, Lenker und Sattel verzurrt werden. So bleibt das Rad im Gelände handlich.
Corona als Trend-Beschleuniger
Corona kann man zweifelsohne mit als Beschleuniger des Bikepacking-Trends verstehen. In Kombination mit der Idee Mikroabenteuer entdecken viele Menschen das Fahrrad als neues Urlaubsvehikel im direkten häuslichen Umfeld, aber auch für kleine Touren und Reisen in Deutschland oder dem nahen Ausland. Zudem machen die Sportlichkeit und Naturnähe das Bikepacking für ambitionierte Radfahrer attraktiv, die sich von gemütlichen Radreisen entlang von Flussläufen nicht angesprochen fühlen. Weiterhin wird das Thema Bikepacking von der steigenden Verbreitung des sogenannten Gravelbikes befördert. Dieses „Breitreifen-Rennrad“ bringt viele Radfahrer von gut ausgebauten Radwegen und Straßen häufig und gerne auf neue Pisten wie Schotterwege (daher der Name Gravel), schlechte Straßen und Waldwege.
Kundengruppen und Wechselwirkung mit Angeboten
Gegenwärtig ist die Bikepacking-Szene noch sehr homogen: abenteuerinteressierte, naturverbundene und sportliche Radfahrer, vorwiegend männlich. Das ist jedoch gerade im Wandel: Hersteller bieten erste Kinderräder mit direktem Bikepacking-Bezug an und auch Frauen sind zunehmend in diesem Reisestil unterwegs. Dazu kommt, dass eine Wechselwirkung zum touristischen Angebot besteht: Regionale Beispiele zeigen klar, dass nicht erst eine größere Nachfrage vorhanden sein muss, um ein Angebot erfolgreich werden zu lassen. Anders gesagt: Es bieten sich vielfältige neue Optionen, um touristische Angebote gezielt zu erweitern, neue Kundengruppen anzusprechen, die Bekanntheit als Raddestination zu erhöhen und das Image zu verbessern.

Kundengruppen gezielt erschließen
Zur Adressierung der wachsenden Gruppe der Bikepacker empfiehlt sich folgender Dreiklang:
Routen
Bikepacker sind durchaus technikaffin. Insofern ist es nicht mehr zwingend notwendig, eine Strecke zu beschildern oder als Karte zu drucken. Letztlich reicht eine Download-Möglichkeit für einen GPS-Track. Dieser sollte aber technisch (keine unnötigen Punkte), aktuell (Stichwort Baustellen, Wegsperrungen usw.) und klar sein. Klar meint, dass der Track abbildet, was angekündigt wird. Eine MTB-Strecke sollte dementsprechend gemäß den gängigen Schwierigkeitsstufen klassifiziert sein und eine Gravel-Strecke sollte Straßen meiden, ohne deckungsgleich mit einer technisch anspruchsvollen MTB-Strecke zu sein. Auch ist es erfahrungsgemäß sinnvoll, lieber verschiedene Versionen einer Route anzubieten, als dass ein Track diverse Schleifen dreht, um Sehenswürdigkeiten, Umfahrungen von technischen Trials oder Anfahrten zu Restaurants zu integrieren.
Rasten
Wo bekomme ich warme Speisen, wo kann ich einkaufen und welche Stellen eignen sich für Picknicks? Das sind Fragen, die viele Bikepacker gerne bei der Planung beantwortet wissen. Jeder baut sich vorab sein „Tourengerüst“ zusammen, das seiner Fahrt eine Struktur gibt. Hier reicht letztlich auch eine Listung auf einer Internetseite, die (siehe Routen) aktuell, korrekt und klar ist. Hinweis: Sofern eine Werbegemeinschaft oder ein Interessenverband Urheber der Listungen wird, kann sich aus dem Gleichbehandlungsgebot seiner Mitglieder und den Ansprüchen der Bikepacker ein Interessenkonflikt ergeben.
Rechtsrahmen
Bikepacker sind auf der Suche nach Natur und Freiheit. Mancher kommt für den Schlaf zurück in die Zivilisation und bucht Fremdenzimmer oder Hotels. Nicht wenige bleiben auch für die Nacht in der Natur und möchten möglichst ungestört sein. Insofern sind Rast- und Biwakplätze, die ein legales nächtliches Lagern ermöglichen, Pfründe, mit denen eine Region wuchern kann. Ein sehr gutes Beispiel sind die Trekkingplätze der Pfalz. Es gibt inzwischen auch Websites und private Initiativen, die dieses Dilemma zu überwinden versuchen, wie etwa 1Nitetent.com.
Was brauchen Bikepacker vor Ort?
Die Tatsache, dass Bikepacker bereits in ganz Deutschland unterwegs sind, erlaubt nicht den Umkehrschluss, dass sie keine besondere touristische oder infrastrukturelle Ansprache benötigen. Vielmehr müssen sie gegenwärtig ohne eine solche auskommen. Vordergründig ist Bikepacking eine Art des Radfahrens, die breiter gedacht ist und neben der Versorgung für viele auch die Outdoor-Übernachtung mit umfasst. Bikepacker sind öfters auch mit Schlafsack, Isomatte etc. unterwegs und schlagen ihr Lager nachts irgendwo in der Natur auf. Genau hier wären neue Regelungen und eine Legalisierung nötig: Denn das Schlafen in der Natur bewegt sich in Deutschland je nach Standortwahl und Ausgestaltung in der rechtlichen Grauzone oder ist gar eindeutig nicht zulässig – im Gegensatz beispielsweise zu Schweden, wo das „Jedermannsrecht“ mit der Auflage „nicht stören und nichts zerstören” gilt. Für Bikepacker, die Naturnähe und Nachhaltigkeit als hohes Gut ansehen, gehört diese Philosophie ganz selbstverständlich zum Kodex.
Neue Chance für Destinationen
Bikepacker sind neue, zusätzliche Touristen und bedeuten zusätzliche Einnahmen. Sie benötigen wenig bis keine neue Infrastruktur, deren Erstellung Zeit und Geld verschlingt. Bikepacker sind zudem auch jenseits der ausgelasteten Sommerferienzeit unterwegs. Sie sind für eine besondere Ansprache adressierbar, sofern diese authentisch ist. Mittelgebirge und hügelige Regionen sind ideal für Bikepacker, was bisweilen vernachlässigte Regionen in den Fokus rückt und dazu beitragen kann, neue touristische Potenziale zu erschließen. Gerade weil das Thema Bikepacking in Deutschland auf touristischer Seite bisher kaum besetzt ist, bietet es Regionen viel Potenzial zur Profilierung.
Events als Zugpferd und lokale Kooperationen
Die Wechselwirkung zwischen Radfahrern und Region lässt sich anhand von „Rennen“ griffiger aufzeigen als anhand von Routen. 2006 starteten 34 Fahrer in Emporia, Kansas, auf einen 200 Meilen (ca. 322 km) langen Rundkurs über unbefestigte Straßen. 2019 gingen beim „Dirty Kanza“ genannten Event 3.600 Fahrer an den Start. Angesichts der großen Abreisedistanzen vermögen es nur wenige Teilnehmer morgens vor dem Start anzureisen und nach der Zieleinfahrt umgehend aufzubrechen. Das Ergebnis ist ein massiver Boost für den lokalen Handel, die Hotellerie und Gastronomie von geschätzten 3 Millionen USD am Rennwochenende. Das berühmte Rennen „Leadville 100“, das seit 1994 jährlich in der alten Minenstadt Leadville, Colorado, stattfindet, wurde überhaupt nur initiiert, um der lokalen Wirtschaft zu helfen. Auch hier spülen knapp 2.000 Teilnehmer samt Entourage viel Geld in eine strukturschwache Region. Ob Bikepacking darüber hinaus als touristisches Format für eine Region funktioniert, hängt sicher auch mit weiteren Maßnahmen und vor allem den lokalen Akteuren in der Region zusammen. Darum sind Initiativen wie „Bikepacking Roots“ wichtig, die Routen erarbeiten und die Kommunikation übernehmen. Gute Ansprechpartner sind auch lokale Fahrradhändler, die die Fahrradszene vor Ort kennen und sich über Kooperationen freuen.
Prominente Bikepacking-Touren in Deutschland
- Bikepacking Trans Germany
- Grenzsteintrophy
- Hanse Gravel
- Mainfranken Graveller
Bilder: www.ortlieb.com | Russ Roca | pd-f, www.pd-f.de / pressedienst-fahrrad, www.ortlieb.com | pd-f

 www.ortlieb.com | Russ Roca | pd-f
www.ortlieb.com | Russ Roca | pd-f Stephan Peters Design
Stephan Peters Design 



 stock.adobe.com - hkama
stock.adobe.com - hkama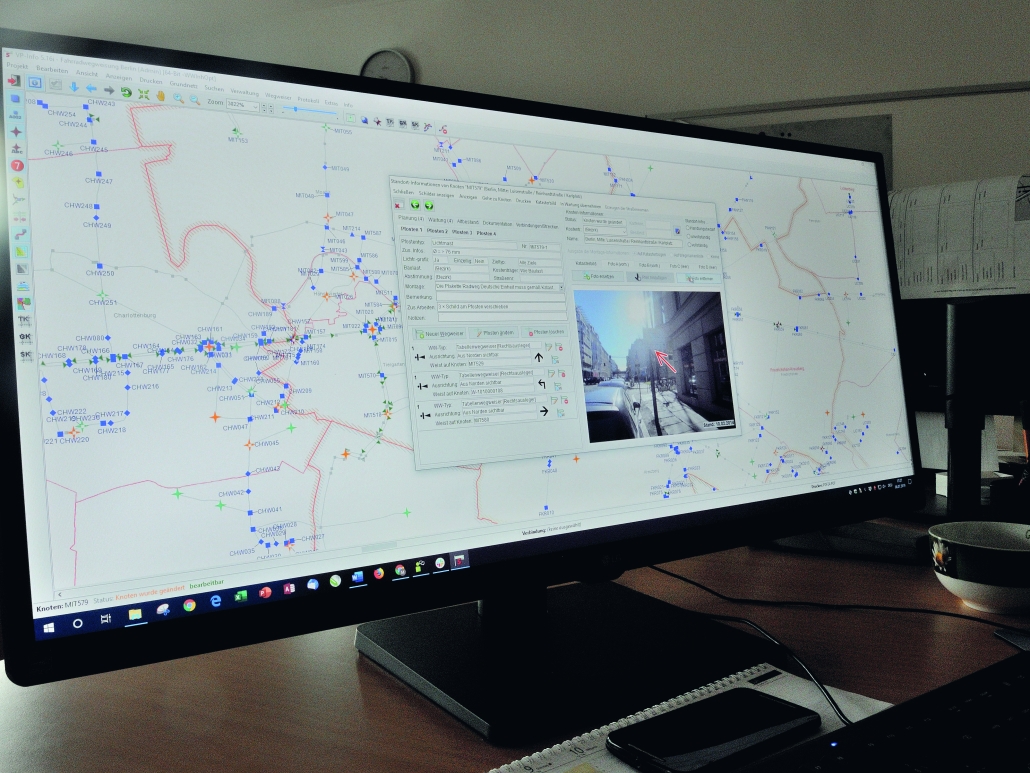

 Georg Trocha
Georg Trocha



 Mailin Busko / Rad und Tour
Mailin Busko / Rad und Tour
 stock.adobe.com - Markus Bormann
stock.adobe.com - Markus Bormann Flyer
Flyer