„In Städten muss der positive Wandel anfangen“
Nach der Einschätzung vieler Experten macht die Corona-Krise Missverhältnisse und Brüche sichtbar und beschleunigt bereits bestehende Prozesse. Auch im Bereich Verkehr? Wir haben dazu mit Professor Stefan Gössling gesprochen, der sich hier als Experte einen Namen gemacht hat. (erschienen in VELOPLAN, Nr. 02/2020, Juni 2020)
Herr Professor Gössling, Sie beschäftigen sich seit Langem intensiv mit den Zusammenhängen von Tourismus, Verkehr und Nachhaltigkeit. Gibt es im Bereich Verkehr Tendenzen, dass sich die Dinge gerade ändern?
Aktuell gibt es viele Debatten insbesondere zum Fahrradverkehr. Es ist aus meiner Sicht sehr positiv, dass jetzt nach vorne gedacht wird. Es scheint ein Konsens zu sein, dass man diese Krise nicht vorbeiziehen lassen darf, sondern sie nutzen sollte, um Änderungen im Verkehrssystem durchzusetzen.
Viele wollen ja möglichst schnell zum alten Zustand zurück. Macht das Sinn?
In Bezug auf den Verkehr war die Situation ja schon vor Corona so, dass die Entwicklungen, die wir hatten, nicht so weiterlaufen konnten. Eine problematische Entwicklung ist der kontinuierliche Zuwachs von Fahrzeugen auf den Straßen. In Deutschland haben wir ein Plus von rund einer Million Fahrzeugen netto pro Jahr. Dazu kommt der Trend hin zu immer mehr SUV und damit zu mehr Platzverbrauch und zu mehr Luftverschmutzung. Auch zu höheren Unfallrisiken.

„In Deutschland gibt es keine Verkehrspolitik, sondern nur eine Industriepolitik, und die ist leider sehr einseitig auf das Auto ausgerichtet.“
Professor Stefan Gössling
Aber das Auto ist ja auch gleichzeitig Deutschland liebstes Kind.
Fast alle Verkehrskonflikte, die wir in Deutschland und weltweit haben, beziehen sich auf das Auto. Unter den Verkehrsforschern ist es ein grundsätzlicher Konsens, dass wir etwas tun müssen, um Abhängigkeiten vom Auto zu reduzieren. Das Auto verbraucht zu viel Platz und hat zu viele negative Externalitäten, von der Luftverschmutzung bis hin zu Unfällen. Das alles wurde in der Verkehrspolitik bislang nicht thematisiert.
Kritiker weisen immer wieder auf die Autozentriertheit von Bundesregierung und Verkehrsministerium hin. Sehen Sie hier ein Problem?
In Deutschland gibt es keine Verkehrspolitik, sondern nur eine Industriepolitik, und die ist leider sehr einseitig auf das Auto ausgerichtet. Man hat nicht systematisch Mobilität als Dienstleistung gefordert und gefördert. Das gilt selbst für grün regierte Städte, die nicht einmal die gerichtlichen Vorgaben durch die von der Deutschen Umwelthilfe geführten Prozesse genutzt haben, um schmutzige Diesel aus den Städten zu verbannen. Maßnahmen, die auch ohne Gerichtsurteile schon längst hätten durchgeführt werden müssen.
Was sind Ihre Vorschläge für Städte und städtische Mobilität?
Ich habe schon früher argumentiert, dass wir Städte als Innovationsorte denken müssen, dass in den Städten der positive Wandel anfangen muss, weil dort die Konflikte, aber auch die Möglichkeiten am größten sind.
Was ist mit einem positiven Wandel gemeint? Autofahrer, Lobbyverbände und Teile der Politik sehen den Radverkehr ja eher als Konkurrenz um Räume.
Mit positivem Wandel meine ich, dass wir Mobilität für alle Menschen gewährleisten müssen und gleichzeitig die Lebensqualität in Städten erhöhen wollen. Das können wir erreichen durch die Förderung von Mikromobilität und insbesondere des Radverkehrs. Wichtig ist es dabei zu bedenken, dass jeder Radfahrer mehr auch einen Platzgewinn für Autofahrer bedeutet, denn nur wenn es uns gelingt mehr Menschen vor allem auf das Fahrrad zu bringen, können wir Räume freimachen. Ein Fußgänger oder Radfahrer braucht nur ein bis zwei Quadratmeter Fläche, ein Autofahrer bei Tempo 50 km/h aber 70 Quadratmeter. Es muss also attraktiver werden, aktiv mobil zu sein, nur dann werden Leute freiwillig auf das Auto verzichten. Darauf baut mein Vorschlag der Mikromobilitätsstraßen: Bei dem Konzept geht es darum, autofreie Nebenstraßen im Netz der gesamten Stadt einzurichten, die es jedem möglich machen, sich zu Fuß, mit dem E-Roller oder dem Fahrrad und ohne Interaktion mit dem Auto, Verkehrsrisiken, Lärm oder Abgasen zu bewegen.

„Jeder Fahrradkilometer bedeutet einen Nutzwert für die Gesellschaft. Autofahrer decken mit ihren Abgaben nur einen Bruchteil der Kosten, die der Gesellschaft entstehen.“
Was ändert sich jetzt gerade durch Corona?
In Städten konnten wir eine dramatische Abnahme des Verkehrsaufkommens sehen, die mit viel besseren Bedingungen für aktive Mobilität einherging. Die Luftverschmutzung nahm ab, ebenso der Lärm und die Enge. Weil ÖPNV und geteilte Formen der Mobilität als unsicher galten, gab es auch eine deutliche Zunahme des Fahrradverkehrs im Modal Split.
Denken Sie, dass es auch mittel- und langfristig zu Veränderungen kommen kann?
Inzwischen gibt es klare Anzeichen dafür, dass sich das Mobilitätsverhalten insgesamt geändert hat. Viele Menschen sind auf aktive Mobilität umgestiegen. Das führt vermutlich dazu, dass auch viele Umsteiger zukünftig beim Rad bleiben: Man fühlt sich mental und physisch besser. Viele Menschen teilen auch die Erfahrung, sich auf dem Fahrrad angstfreier und ohne Luftverschmutzung fortbewegen können. Deshalb haben wir aktuell tatsächlich ein Window of Opportunity, um auch langfristig mehr Menschen aufs Fahrrad zu bringen. Denn natürlich wird das Interesse am Rad mit wieder zunehmendem Autoverkehr in den Städten auch wieder sinken.
Sind die Menschen jetzt eher bereit für einen Umstieg vom Auto aufs Fahrrad?
Die Barriere für einen Umstieg war bislang die große Bindung, die man ans Auto hat, die über funktionale Aspekte weit hinausgeht – das Auto hat viele symbolische und affektive Werte, die durch die Ängste vor Infektionen noch verstärkt worden sind. Damit zu brechen, ist natürlich wahnsinnig schwierig. Aber genau das passiert im Moment in einem Teil der Gesellschaft. Ein anderer Teil, insbesondere auf dem Land, wird vermutlich stärkere Bindungen ans Auto entwickeln.
Der Städtetag sagt, die Kommunen wollen eine Verkehrswende. Ist ein höherer Radverkehrsanteil realistisch?
Wenn man Mikromobilitätsstraßen permanent einführte, dann könnte man in Städten auch einen viel höheren Radfahreranteil erreichen. Die besten deutschen Städte haben einen Anteil von vielleicht 35 bis 40 Prozent Radverkehr an den Fahrten im Stadtgebiet. In den Niederlanden werden deutlich höhere Werte erreicht, das heißt, es ist noch viel Spiel im System.
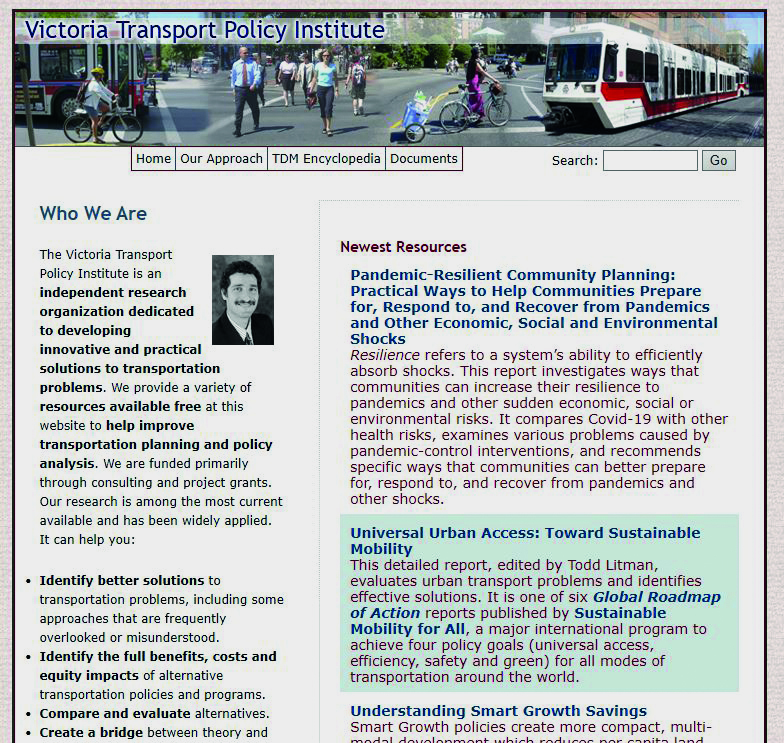
Mehr lesen. Eine Empfehlung von Prof. Stefan Gössling.
Todd Litman vom kanadischen Victoria Transport Policy Institute, einer unabhängigen Forschungsorganisation, gehört zu den führenden Stadt- und Verkehrsplanern weltweit. Auf der Instituts-Website werden kostenlos Ressourcen zur Verfügung gestellt, um die Verkehrsplanung und die Analyse der Verkehrspolitik zu verbessern. Ein aktueller Beitrag befasst sich mit der resilienten und Pandemieresistenten Planung von Städten und Kommunen. Aufgezeigt werden praktische Möglichkeiten zur Unterstützung bei der Vorbereitung, Reaktion und Erholung von Pandemien und anderen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Schocks. Zudem wird untersucht, wie Gemeinschaften ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Pandemien und anderen plötzlich auftretenden wirtschaftlichen, sozialen oder ökologischen Risiken erhöhen können.
Mehr unter vtpi.org
Was sollten Städte und Kommunen konkret tun?
Ich gehe immer davon aus, dass man die Transportmittelwahl nicht erzwingen kann. Man kann aber bestimmte Verkehrssysteme attraktiv machen. Und dann muss man es den Menschen überlassen, ob sie dieses Angebot annehmen. Ich denke aber, dass alle Studien in dieser Richtung zum gleichen Schluss kommen: Wenn man die Voraussetzungen für Fahrradstädte schafft, dann fahren die Menschen auch Rad. Wir haben beispielsweise in unserer Forschung nachgewiesen, dass Radfahrer erhebliche Umwege fahren, um motorisiertem Verkehr auszuweichen, also Abgasen, Lärm und Verkehrsrisiken. Wenn man gute Infrastruktur für mehr Radverkehr schafft, dann steigen viele Leute freiwillig um, noch mehr, wenn Mikromobilitätsstraßen eingeführt werden. Die Menschen fahren eigentlich sehr gerne Rad – das wird gerade in der Corona-Krise klar.
Viele Verbände fordern jetzt Anreize für umweltfreundliche Mobilität statt Kaufprämien für Autos. Was halten Sie davon?
Der große Erfolg der Fahrradleasing-Anbieter zeigt, dass schon ein kleiner finanzieller Anreiz einen Grund darstellt, um umzusteigen. Ich würde mir wünschen, dass der ökonomische Nutzen, den Radfahrer für die Gesellschaft erbringen, denn sie sind Kostensparer, auch wieder an sie ausgezahlt wird. Für jeden Radfahrer und jeden Kilometer.
Sie haben den ökonomischen Nutzen von Radfahren in der Vergangenheit ja schon konkret berechnet.
Richtig, im Rahmen einer Kosten-Nutzen-Analyse haben wir einen Vergleich zwischen Auto- und Radfahren gezogen. Bezieht man alle Faktoren ein, dann hat ein Fahrradkilometer einen Nutzen von 30 Cent für die Gesellschaft. Radfahren kann beispielsweise ganz massiv zur Entlastung der Gesundheitssysteme beitragen. Der Betrag wird quasi von Radfahrern erwirtschaftet, allerdings ohne dass bislang ein Ausgleich stattfindet.
Radfahren bringt also einen Nutzen für die Gesellschaft, wie verhält es sich mit Autofahren?
Ein mit dem Auto zurückgelegter Kilometer bedeutet gesellschaftliche Kosten von rund 20 Cent. In dieser Berechnung ist bereits berücksichtigt, dass Autofahrer erhebliche Steuern und Abgaben zahlen, die man mit acht Cent pro Kilometer ansetzen kann. Die größten Autokosten entstehen durch Lärm, den Ausbau von Verkehrsinfrastruktur und deren Erhalt sowie die Verfügbarkeit kostenfreier Parkplätze. Dazu kommen noch viele andere Kosten, wie die des Klimawandels. Negative Auswirkungen auf die Lebensqualität und den Tourismus sind in unserer Berechnung zum Beispiel noch gar nicht berücksichtigt, weil sie sich schlecht quantifizieren lassen.

Bei Verkehrsforschern und auch beim Deutschen Städtetag gibt es einen Konsens zur Reduzierung der Abhängigkeiten vom Auto.
Neben dem Verkehr steht ja vor allem das Autoparken in der Kritik. Haben Sie dazu Lösungsvorschläge?
Das durchschnittlich europäische Auto wird vermutlich 97 Prozent der Zeit nicht genutzt. In manchen Städten wird der eigene Wagen ja schon manchmal nicht mehr genutzt, weil man Angst hat, dass man bei der Rückkehr keinen Parkplatz mehr findet. Wenn solche Situationen entstehen, dann ist man wirklich in einer Sackgasse angekommen. Deswegen können wir auch mit deutlich weniger Autos auskommen. Zu den Kosten: Parkraum ist steuerlich subventioniert. Das fängt beim Anwohnerparkplatz an, der mit 30 Euro pro Jahr abgerechnet wird. Es wird eigentlich in keiner Stadt wirtschaftlich errechnet, was dieser Platz eigentlich wert ist. Der Kollege Donald Shoup in den USA fordert, dass vor allem Parkplätze in der Innenstadt prinzipiell so teuer sein müssten, dass immer eine ausreichende Zahl freier Plätze, ungefähr 15 Prozent, verfügbar ist. Das könnte ein Ausgangspunkt für die Bewirtschaftung sein.
Wie sollte die künftige staatliche Steuerung von Mobilität Ihrer Meinung nach aussehen?
Die Kosten-Nutzen-Analyse zeigt, dass wir eine Schere haben, die stark auseinanderklafft: Das Auto kostet, das Fahrrad nutzt. Volkswirtschaftlich betrachtet sollte diese Schere zunehmend geschlossen werden. Generell ist es sicher wünschenswert, dass der Autofahrer die Kosten trägt, die er verursacht. Das würde aus meiner Sicht bedeuten, dass Autofahren teurer werden muss. Auf der anderen Seite könnte man alternative Verkehrsmittel, wie das Fahrrad, fördern, indem man zum einen ökonomische Anreize schafft und zum anderen auch einen infrastrukturellen Ansatz verfolgt, in dem mehr Geld für das Fahrrad investiert wird. Die aktuell diskutierten Kaufprämien für Autos und der Abbau von Förderungen für Lastenräder führen in die absolut falsche Richtung.
Müsste man mit Blick auf Corona, Investitionsprogramme und den Klimawandel jetzt anders handeln?
Eigentlich sollte man Corona als Chance wahrnehmen – das tun auch viele Städte, nur leider kaum in Deutschland. Für mich ist klar, dass die potenziellen Störungen durch den Klimawandel im Wirtschaftssystem um ein Vielfaches schlimmer ausfallen werden als das, was wir gerade mit Corona erleben. Das wird allein deshalb deutlich, weil Klimawandel nicht kurzfristig, sondern permanent sein wird. Deshalb empfehle ich, aus der aktuellen Krise heraus auch langfristig Schlüsse zu ziehen über die Umgestaltung von Verkehrssystemen. Wir sollten die Systeme in den Städten auf einer viel fundamentaleren Ebene ändern. Immer mehr und größere Autos in Städten – es muss ja jedem klar sein, dass das nicht gehen wird. Wer jetzt handelt, handelt also langfristig und auf der Basis ökonomischer Vernunft.
Über Professor Stefan Gössling
Stefan Gössling hat in Münster und Freiburg studiert und ist heute Professor für nachhaltigen Tourismus und nachhaltige Mobilität an der schwedischen Linnaeus-Universität. Neben seiner Lehrtätigkeit ist er unter anderem als Berater von Regierungen und supranationalen Organisationen tätig und hat zahlreiche Fachbeiträge und Bücher veröffentlicht. Er ist Initiator des Mobilitätsforschungszentrums Transportation Think Tank Freiburg (t3freiburg.de).
Buchtipp: „The Psychology of the Car: Automobile Admiration, Attachment, and Addiction.“ (2017)
Bilder: Kara – stock.adobe.com, vtpi.org, Pixabay,

 Kara - stock.adobe.com
Kara - stock.adobe.com SimpLine - stock.adobe.com
SimpLine - stock.adobe.com Reiner Kolberg
Reiner Kolberg
 www.ortlieb.com | pd-f
www.ortlieb.com | pd-f Reiner Kolberg
Reiner Kolberg Rolf Schulten
Rolf Schulten Stefan Wallmann
Stefan Wallmann Radkomm, verenafotografiert.de
Radkomm, verenafotografiert.de SimpLine - stock.adobe.com
SimpLine - stock.adobe.com Dr. Achim Schmidt
Dr. Achim Schmidt