Sharing-Angebote werden meistens mit einem urbanen Umfeld assoziiert. Das Beispiel BARshare im brandenburgischen Landkreis Barnim zeigt jedoch, dass Sharing von E-Autos und Lastenrädern auch auf dem Land Potenzial besitzt. Auch wenn es dort etwas anders funktioniert als beispielsweise im benachbarten Berlin. (erschienen in VELOPLAN, Nr. 03/2022, Sept. 2022)
Die Bürger von Melchow fühlten sich von ihren Nachbargemeinden lange Zeit abgeschnitten. Zwar hält in dem 1000-Einwohner-Ort im brandenburgischen Landkreis Barnim sogar ein Regionalzug, aber davon haben insbesondere die älteren Be-wohnerinnen wenig. „Der Weg zum Zug und die Wege am Zielort sind für viele von ihnen zu weit und die Wartezeiten zu lang“, sagt Ronald Kühn, ehrenamtlicher Bürgermeister des Ortes. Die Älteren, die nicht mehr selbst Auto fahren können, brauchten einen Shuttle in die umliegenden Orte, wo sie einkaufen, zum Arzt oder zur Therapie gehen. Aber sämtliche Anfragen Kühns bei Busunternehmen oder Ride-Sharing-Anbietern blieben erfolglos. Das Kernproblem ist: Herkömmliche Sharing-Systeme passen nicht in den ländlichen Raum. Sie sind dort nicht wirtschaftlich. Deshalb organisieren die Menschen ihre Alltagsmobilität dort in Eigenregie je nach Familiengröße mit einem, zwei oder mehr Autos. Die Kreiswerke Barnim (KWB) suchten nach einer Lösung für dieses Problem. Das war nicht einfach. Der Landkreis Barnim grenzt im Norden an die Uckermark und im Süden an Berlin. Dazwischen gibt es viel Landwirtschaft, Seen und Naherholungsgebiete. Die Menschen leben verstreut in einer Handvoll Kleinstädte und Gemeinden mit wenigen Tausend Einwohnern wie Biesenthal oder Chorin. Die Mehrzahl der Orte wie Ziethen oder Liepe kommt sogar nur auf ein paar Hundert Einwohner. In den beiden Bevölkerungszentren Eberswalde und Bernau leben jeweils knapp über 40.000 Menschen. „Mit BARshare wollen wir ein alltagstaugliches Sharing-System für den ländlichen Raum anbieten, das wirtschaftlich ist, die CO₂-Emissionen im Verkehr senken und die Auslastung vorhandener Fuhrparks erhöhen“, sagt Christian Vahrson, Prokurist bei der KWB. Sie entwickelten schließlich mit BARshare ein Sharing-Konzept, das ausschließlich Elektrofahrzeuge verwendet und zwei Nutzergruppen kombiniert, die Hauptnutzer und die Mitnutzer. 2019 ging BARshare mit 23 Elektrofahrzeugen an den Start. Der Knackpunkt für das Sharing-Konzept war: Hauptnutzer zu finden, die bereit waren, ihre Dienstwagenflotte auf E-Fahrzeuge umzustellen und die Fahrzeuge dann privaten Nutzerinnen zur Verfügung zu stellen. Die Ausgangssituation war gut. Vahrson und sein Team hatten erkannt, dass es bereits Hunderte potenzielle Kandidaten im Landkreis gab. Dazu gehören Verwaltungen, Kommunen, Wohnungsgenossenschaften, Unternehmen oder auch Vereine. „Fahrzeuge gemeinsam nutzen, gehört im dienstlichen Kontext zum Alltag. Die Mitarbeiter teilen sich bereits Dienstwagen“, sagt Vahrson. Allerdings nutzen sie die Fahrzeuge nur tagsüber, während der Bürozeiten. Danach stehen sie herum. An diesem Punkt setzt die BARshare-Idee der Mitnutzer an: Außerhalb der Arbeitszeiten können Privatleute die Elektrofahrzeuge für ihre Fahrten mieten. Das Konzept von BARshare kombiniert also dienstliche und private Nutzung, einfach und digital.
Als kommunales Unternehmen sind wir den Hauptnutzern ein zuverlässiger Partner
Christian Vahrson
Servicepaket für Fuhrparkbetreiber
Um die Fuhrparkbetreiber zum Umstieg zu bewegen, entwickelte BARshare ein Rundum-sorglos-Paket. Dazu gehört, dass BARshare wie herkömmliche Sharing-Anbieter der Flottenbetreiber ist. Sämtliche Fahrzeuge gehören BARshare und damit den Kreiswerken Barnim. „Als kommunales Unternehmen sind wir den Hauptnutzern ein zuverlässiger Partner. Durch die vertraglichen Vereinbarungen stehen die Fahrzeuge gesichert und dauerhaft zur Verfügung“, sagt Vahrson. Außerdem baut BARshare die Ladeinfrastruktur an den Standorten der Hauptnutzer auf, stellt die Buchungssoftware zur Verfügung und kümmert sich um Reinigung, Service und Reparatur. Für die Hauptnutzer ist das bequem. „Die Unternehmen oder Verwaltungen mieten nicht das komplette Fahrzeug, sondern nur ein gewisses Stundenkontingent. Auf diese Weise können sie ihre bestehende Dienstwagenflotte erweitern oder durch klimafreundliche Elektroautos ersetzen“, sagt Saskia Schartow, Projektleiterin von BARshare. Der Nebeneffekt ist: Die Unternehmen verbessern ihre Klimabilanz, wenn sie vom Verbrenner auf Elektromobilität umsteigen.
Der Aufbau des Angebots war kostspielig. 42 Elektroautos, vom kleinen Stadtflitzer bis zum Siebensitzer-Van stehen inzwischen an 23 Standorten im Landkreis. Das konnte der Landkreis Barnim mit seinen rund 185.000 Einwohnern nicht in Eigenregie finanzieren. „Die Fahrzeuge und den Aufbau der Ladeinfrastruktur haben wir mit Unterstützung verschiedener Fördermittel vom Land Brandenburg, dem Europäische Fonds für regionale Entwicklung und dem Bundesverkehrsministerium finanziert“, sagt Vahrson. Mit den Einnahmen aus dem Sharing-Betrieb deckt das BARshare-Team nun die laufenden Kosten der Flotte. Dazu gehören unter anderem der Betriebsservice, die Versicherung, der Hotline-Service oder die Software für das Buchungssystem nebst App.
Das Sharing-Angebot kommt im Landkreis gut an. Inzwischen nutzen 20 Barnimer Unternehmen, Verwaltungen oder auch Wohnungsgenossenschaften den Service. „Über sie sind rund 700 Fahrer und Fahrerinnen registriert“, sagt Projektleiterin Saskia Schartow. Dazu kommt die große Resonanz aus der Bevölkerung: 1800 private Nutzer haben sich seit 2019 angemeldet und die Tendenz ist weiterhin steigend.


BARshare interessant für Pendlerinnen
Eine von ihnen ist Helga Thomé aus Eberswalde. Als Coach für Team- und Organisationsentwicklung ist sie beruflich häufig in Berlin und Brandenburg unterwegs. „Nach Berlin fahre ich immer mit der Bahn“, sagt sie. Für die Strecken ins Umland braucht sie ein Auto. Ihren eigenen Wagen hat sie verkauft, bevor sie das BARshare Auto getestet hat. „Wären die Kosten durch die Decke gegangen, hätte ich über den Kauf eines eigenen Wagens wieder nachgedacht. Das muss ich allerdings nicht“, sagt sie. Für sie ist das Mieten günstiger. „1300 Euro habe ich im ersten Halbjahr 2022 an Mietkosten ausgegeben“, sagt sie. Das klingt viel. Aber wenn sie die laufenden Kosten wie Kfz-Versicherung, anfallende Reparaturen bis hin zum Wertverlust einbeziehe, sei das BARshare-Auto für sie deutlich günstiger und zudem noch umweltfreundlicher. „Außerdem muss ich mich nicht mehr um Werkstattbesuche oder den Reifenwechsel kümmern. BARshare übernimmt sogar das Waschen des Autos“, sagt sie.
Für Helga Thomé ist das Sharing-Angebot eine gute Ergänzung zum bestehenden Angebot. In der Kreisstadt Eberswalde erledigt sie die meisten Wege mit dem Fahrrad. Hat sie mal keine Lust zum Radfahren, steigt sie in einen der Busse, die regelmäßig in der 43.000 Einwohner-Stadt unterwegs sind.


Alltagsmobilität in Landgemeinden sicherstellen
Von dieser Auswahl träumen die 1000 Einwohner von Melchow. In ihrem Dorf stellt ein BARshare-Siebensitzer seit 2019 für sie nun die Basismobilität wieder her. Um die Lade-infrastruktur und den Wagen zu erhalten, brauchte der Ort allerdings einen Hauptnutzer. Dafür haben die Dorfbewohner den Verein „Melchow mobil“ gegründet. Aktuell zählt er rund 40 Mitglieder. Etwa 15 von ihnen steuern den Bus. Momentan fährt das Elektrofahrzeug laut Bürgermeister Kühn zweimal täglich in die umliegenden Gemeinden. „Wenn der Bus nach Biesenthal zur Einkaufsfahrt aufbricht oder samstags zu den ‚Guten Morgen Eberswalde‘-Konzerten, ist jeder Sitz besetzt“, sagt er. Nur wenn es zum Arzt oder zur Therapie geht, sei in der Regel nur eine Person unterwegs. Selbst im Coronajahr 2021 unternahm der Bus 300 Touren und sammelte 12.000 Kilometer. Die Kosten für die Mitfahrenden sind überschaubar. 50 Euro kostet die Vereinsmitgliedschaft eine Einzelperson im Jahr, Familien zahlen das Doppelte. „Die Gemeinde Melchow unterstützt den Verein finanziell, um mit dem Siebensitzer die Alltagsmobilität zu sichern“, sagt Ronald Kühn.
Zwischen 250 und 450 Euro kosten die Elektrofahrzeuge bei BARshare für Hauptnutzer je nach Stundenkontingent im Monat. Hinzu kommt noch eine Kilometerpauschale von 0,084 Euro. Mitnutzer zahlen je nach Tageszeit und Fahrzeuggröße zwischen 1,90 und 4,90 je Stunde plus eine Buchungsgebühr von 2 Euro und 10 Cent Kilometerpauschale. Lastenräder sind mit 2 Euro je Stunde und einem Euro Buchungsgebühr nicht wesentlich günstiger.
Allerdings decken die Einnahmen die anfallenden Kosten von BARshare noch nicht. „Das Wachstum geht aber in die richtige Richtung, wir kommen der Wirtschaftlichkeit immer näher“, sagt Vahrson. Er rechnet damit, dass sich BARshare in wenigen Jahren selber trägt. Die Corona-Pandemie war auch für den Sharing-Anbieter eine Herausforderung. „Uns fehlten die öffentlichen Veranstaltungen, um das Angebot bekannter zu machen und mit den Menschen direkt ins Gespräch zu kommen“, sagt Saskia Schartow. Mit Informations- und Bedienvideos auf der BARshare-Webseite versuchte das Team Berührungsängste abzubauen. „Aber Elek-tromobilität und Carsharing sind für viele Menschen noch ungewohnt. Um bestehende Hemmschwellen abzubauen, hilft eine begleitete Probefahrt“, sagt sie. Neue Hauptnutzer bekommen deshalb stets eine persönliche Einführung in das Fahrzeug und den Ausleihvorgang.
Autos und Minibusse sind jedoch nicht das einzige Mittel, um auf dem Land klimaneutral unterwegs zu sein. Mithilfe von E-Bikes und E-Lastenrädern lassen sich viele Wege auch zwischen den Ortschaften zurücklegen. Der Vorteil: Die Investitionen und Unterhaltskosten sind erheblich geringer als die Anschaffung von Elektroautos. Allerdings benötigt es hier noch mehr Kommunikationsarbeit, damit die Räder tatsächlich genutzt werden.
Uns fehlten die öffentlichen Veranstaltungen, um das Angebot bekannter zu machen und mit den Menschen direkt ins Gespräch zu kommen.
Saskia Schartow, Projektleiterin von BARshare
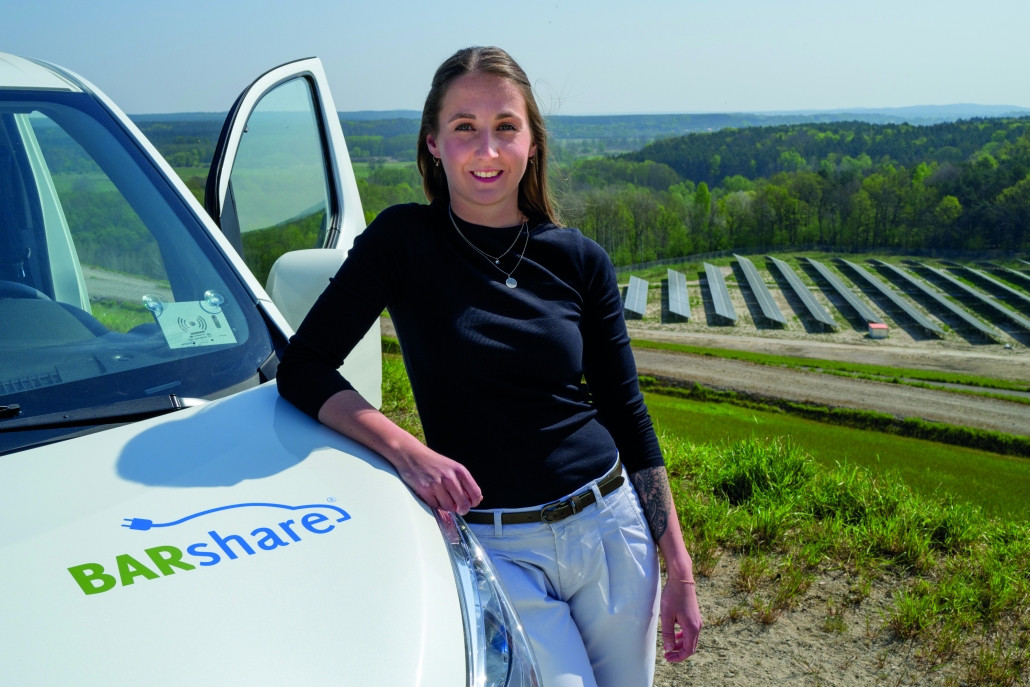
E-Bikes ergänzen die Flotte
BARshare setzt auch dabei auf das persönliche Erlebnis. Eine Probefahrt im geschützten Raum ist für die Ausleihe der fünf Cargobikes entscheidend. In urbanen Zentren gehören Lastenräder längst zum Stadtbild. „Im Kreis Barnim sieht man sie selten. Für viele sind sie eine komplett neue Fahrzeugkategorie“, sagt Saskia Schartow. Vor der ersten Ausleihe steht deshalb immer die Probefahrt. Bei den E-Bikes und den Cargobikes ist die Lernkurve des BARshare-Teams besonders steil. Kaum hatte eines der ersten Lastenräder seinen Standort bei der Wohnungsgenossenschaft Eberswalde bezogen, wurde es gestohlen. Ein paar Tage später tauchte es zwar wieder auf, allerdings fehlten die Laufräder.
„Wir müssen sie nicht nur vor Wind- und Wetter schützen, sondern auch vor Vandalismus“, sagt Saskia Schartow.
Mit ihrem Bike-Sharing-Angebot leistet das BARshare-Team im ländlichen Raum Pionierarbeit. Neben der Infrastruktur fehlt oft die Akzeptanz in der Bevölkerung. „Hier nutzen nur wenige das Fahrrad im Alltag“, sagt Saskia Schartow, „aber wir wollten auch Menschen ohne Führerschein E-Mobilität ermöglichen.“ Inzwischen können sie BARshare-E-Bikes oder -E-Lastenräder am Bahnhof, an der Mobilitätsstation in Werneuchen (10.000 Einwohner) und im Fahrradparkhaus in Bernau (42.000 Einwohner) ausleihen. Die Ausleihen liegen noch im niedrigen dreistelligen Bereich, aber sie steigen ebenfalls.
„Unser Angebot bietet nicht für jeden eine Lösung. Aber wir bieten bereits heute mit unseren Elektrofahrzeugen ein Angebot für verschiedene Mobilitätsbedürfnisse an und steigern die Lebensqualität der Menschen spürbar“, sagt Saskia Schartow. Mit dem Sharing-Konzept will der Landkreis Barnim auch die eigene Klimabilanz verbessern. Bereits 2008 hatte der Kreistag beschlossen, dass die Energie für das tägliche Leben langfristig ausschließlich aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen werden soll. Die Kreiswerke Barnim setzen als 100-prozentige Tochtergesellschaft des Landkreises Barnim nun auch mit BARshare die Ziele des Landkreises um.
Bilder: Torsten Stapel

 Torsten Stapel
Torsten Stapel SenUMVK – R.Rühmeier
SenUMVK – R.Rühmeier
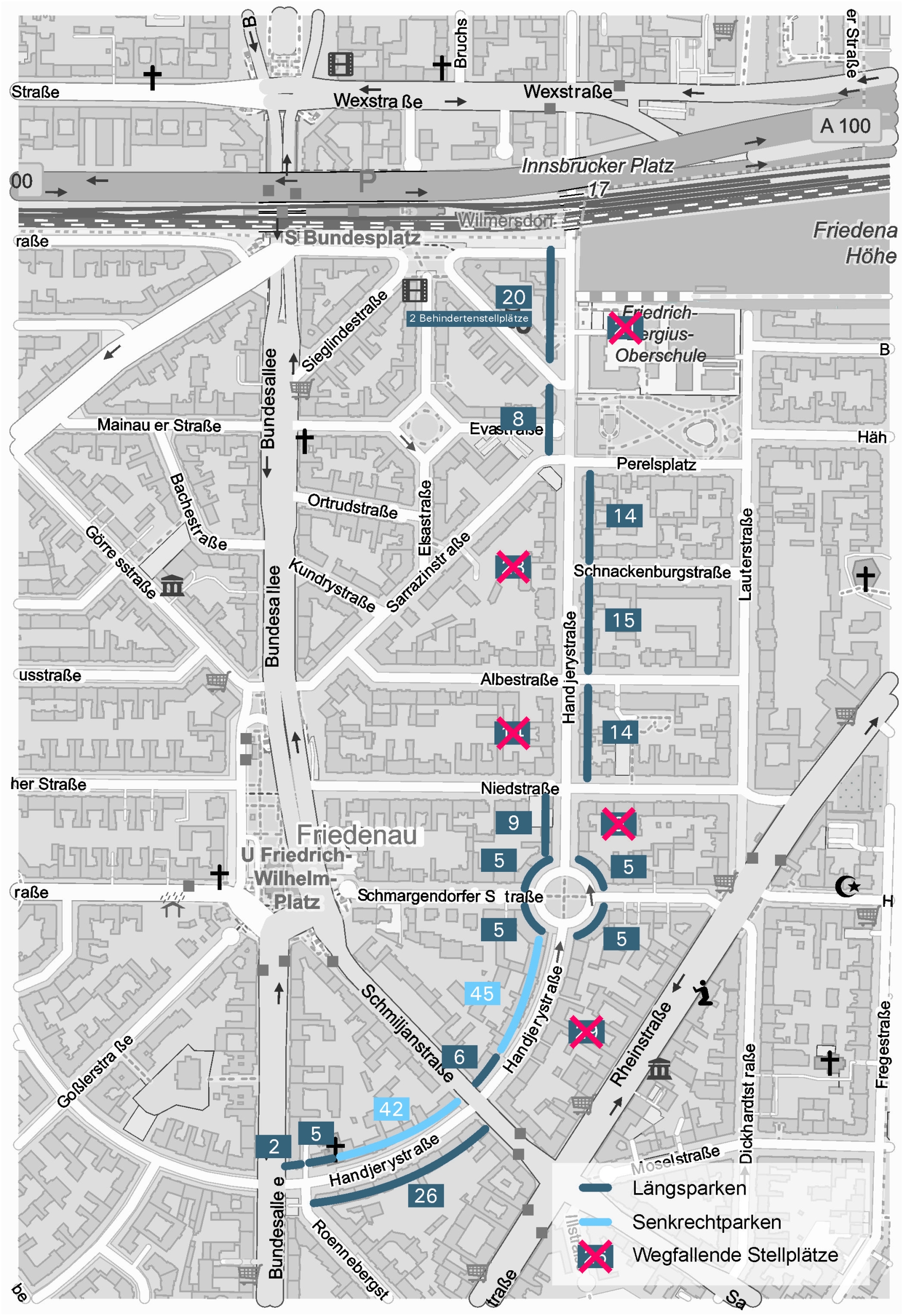
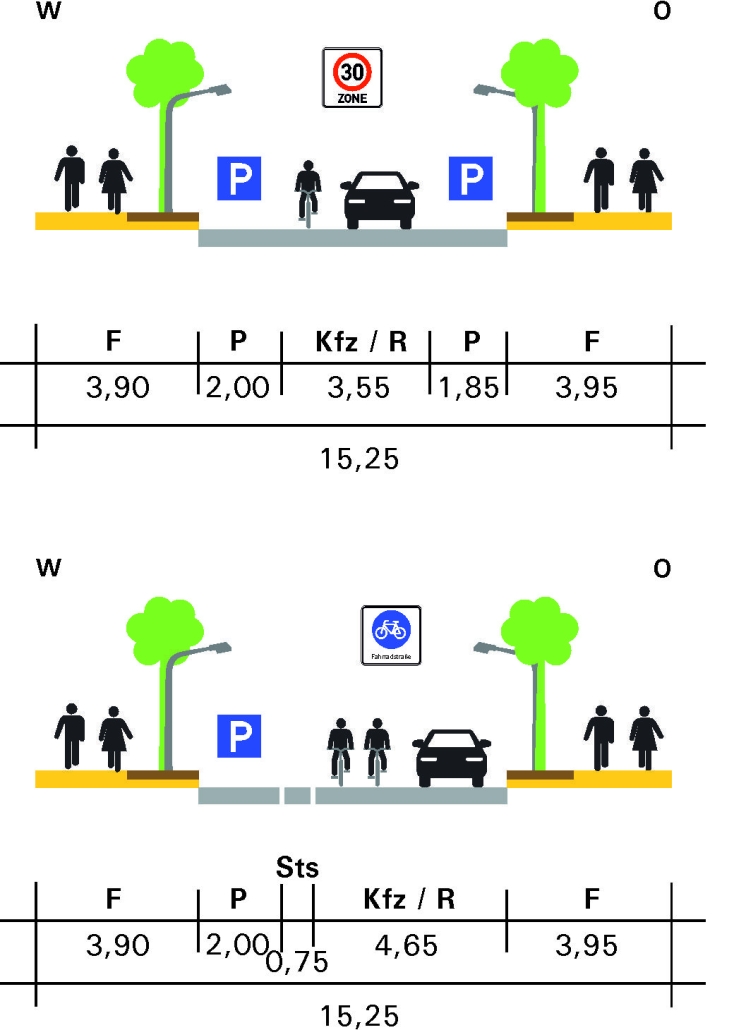









 Openstreetmap – Schmidt-Buch-Verlag
Openstreetmap – Schmidt-Buch-Verlag



 foto@bopicture.de
foto@bopicture.de



 stock.adobe.com – luckybusiness
stock.adobe.com – luckybusiness





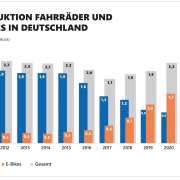 ZIV
ZIV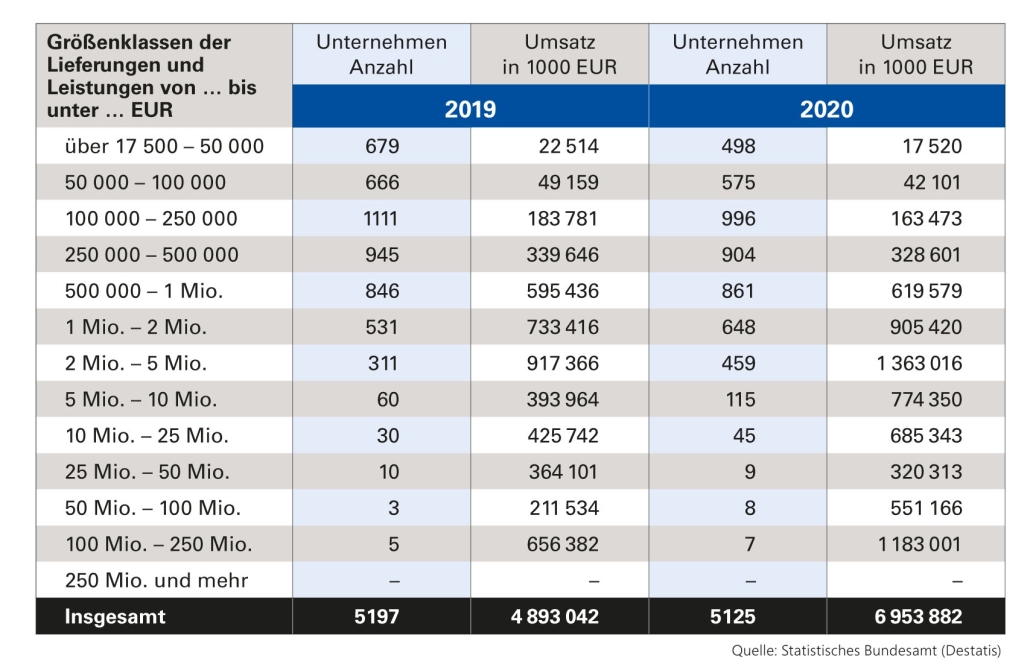
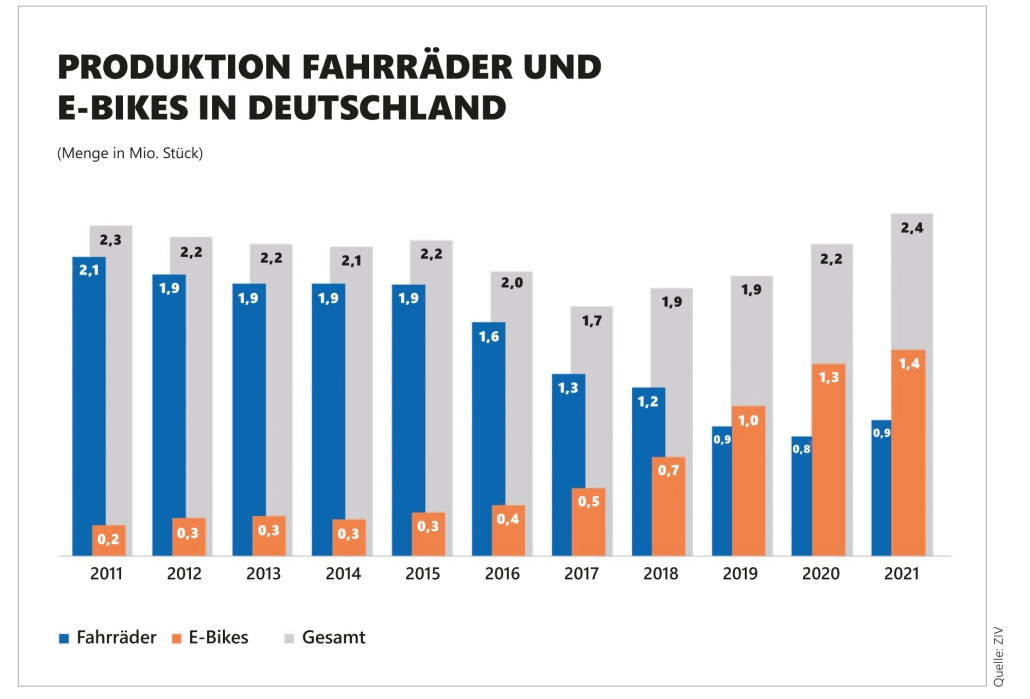
 Georg Bleicher
Georg Bleicher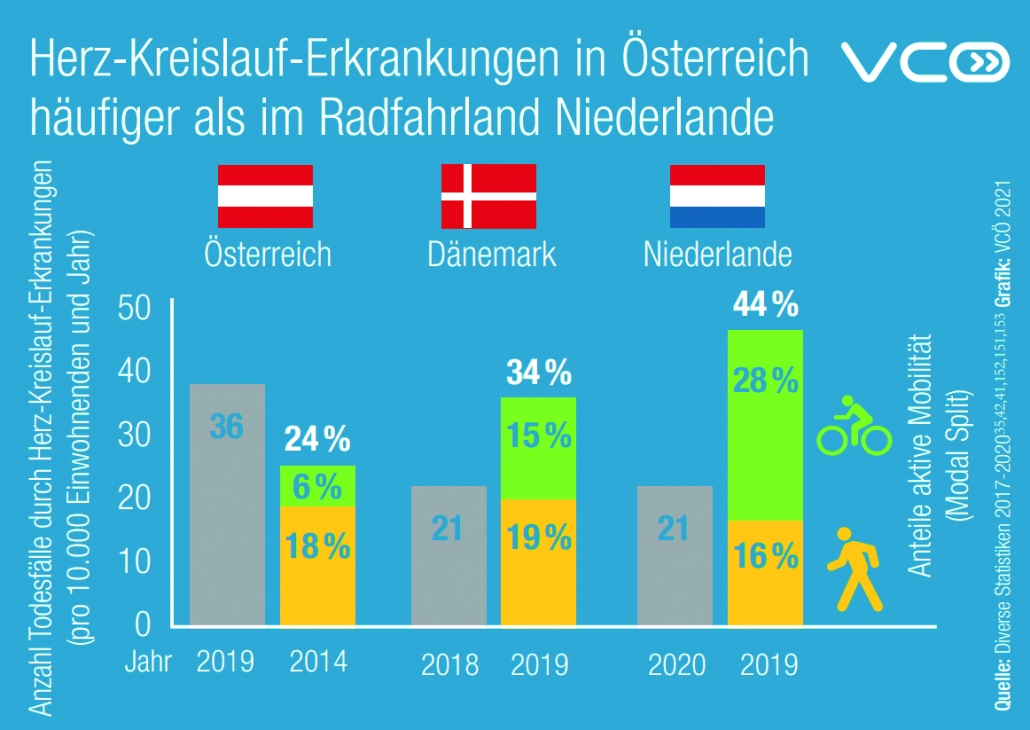

 stock.adobe.com – Kara
stock.adobe.com – Kara




 Clear Channel
Clear Channel









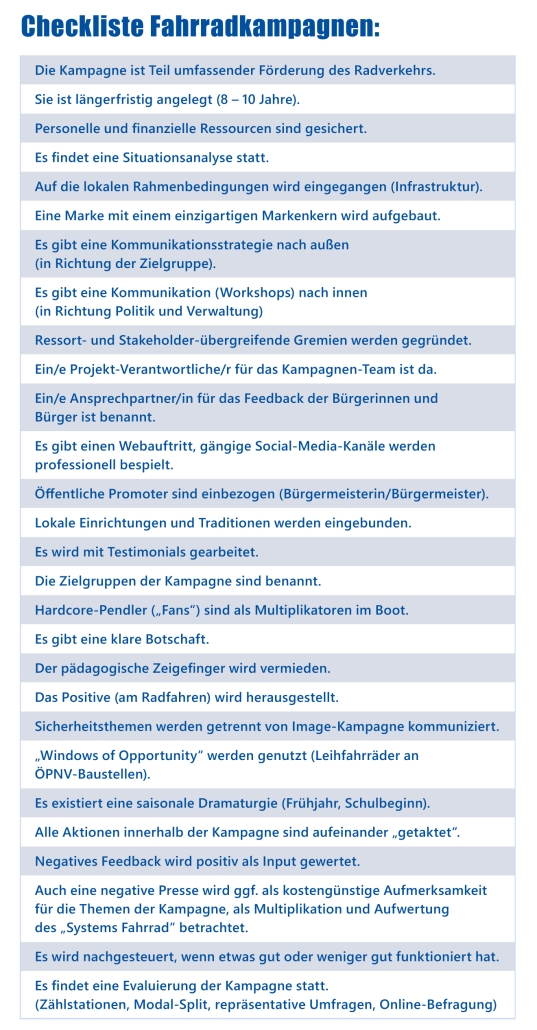

 Fachhochschule Erfurt (FHE) – Institut Verkehr und Raum
Fachhochschule Erfurt (FHE) – Institut Verkehr und Raum




