Die Stadt Bonn wurde beim diesjährigen Fahrradklimatest des ADFC als Aufsteiger ausgezeichnet. Auf dem Weg dahin hat der Radentscheid seine Wirkung bisher nur teilweise entfalten können. Die gesunde Zusammenarbeit der Stadt mit den Freiwilligen des Radentscheids lässt hoffen, dass die großen Schritte noch in der Zukunft liegen. (erschienen in VELOPLAN, Nr. 03/2023, September 2023)
Von 4,2 auf 3,8: Was erst mal nicht nach viel klingt, war für den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) Grund genug, Bonn als Top-Aufsteiger-Stadt im diesjährigen Ranking des Fahrradklimatests aufzuführen. Keine andere Stadt zwischen 200.000 und 500.000 Einwohnerinnen hatte sich zwischen 2021 und 2022 deutlicher verbessert. Das Infrastrukturangebot in Bonn verändert sich insbesondere seit dem Regierungswechsel. Seit 2020 regiert eine Koalition unter Oberbürgermeisterin Katja Dörner von den Grünen. Im Vorfeld der Wahl sammelte das Bündnis Radentscheid Bonn zudem Stimmen für ein Bürgerbegehren. Die notwendigen Unterschriften kamen in ein paar Monaten zusammen. Bis zur Kommunalwahl im Herbst desselben Jahres suchte man weiterhin Unterstützerinnen. Letztendlich wurden 28.000 Unterschriften an die Stadtspitze übergeben. Damit war der Radentscheid das bisher größte Bürgerbegehren der Stadt. In einer der ersten Sitzungen der neuen Regierungskoalition schloss diese sich dem Radentscheid mit über 80 Prozent der Stimmen an. Die Freiwilligen sind auch weiterhin in die Planungen involviert und führen einen regen Austausch mit der Verwaltung. Zunächst tauschten sich die Stadt und der Radentscheid alle vier Wochen zu aktuellen Zwischenständen aus. Mittlerweile ist der Turnus sechswöchig. Bei den Treffen sind alle wichtigen Ämter, darunter das Ordnungsamt, das Stadtplanungsamt, das Tiefbauamt und die Straßenverkehrsbehörde anwesend. Auch das städtische Abfall- und Straßenreinigungsunternehmen Bonn Orange ist regelmäßig beteiligt. Seit dem Radentscheid ist die Verwaltung nicht nur finanziell, sondern auch personell besser aufgestellt. Zuvor waren 2,5 Stellen im Stadtplanungsamt für den Radverkehr zuständig. Mittlerweile ist das Team inklusive einem Fußverkehrsbeauftragten siebenköpfig. Der ist dort laut Felix Maus, der das Radverkehrs-Team leitet, gut aufgehoben. „Wir wollen ja nicht den Fehler machen, dass wir jetzt die fahrradgerechte Stadt bauen“, so Maus, also eine Stadt, die die Fußgänger vergessen würde. Menschengerecht soll sie stattdessen sein.
Steffen Schneider vom Radentscheid kritisiert, dass den Akteuren in diversen Ämtern eine gemeinsame Steuerung fehlt. Mit dem Radverkehrs-Team, das im Stadtplanungsamt auch mit der Umsetzung des Radentscheids betreut ist, zeigt er sich aber nicht unzufrieden. Felix Maus beschreibt sein Verhältnis zum Radentscheid: „Im Prinzip zerren ganz viele Leute an uns und wir versuchen das Bestmögliche rauszukriegen in der Abstimmung mit der Verwaltung.“ Das Radverkehrs-Team fungiert als Vermittler zwischen dem Radentscheid und anderen Teilen der Verwaltung. Der Radentscheid bedeute in der Planungspraxis viel Druck, sorge aber auch für Rückendeckung, weil das Team von Felix Maus auf diesen verweisen kann. Team-Mitglied Christina Welt erklärt: „Der wichtigste Punkt ist der Beschluss, dass sich der Hauptausschuss dem Begehren angeschlossen hat und dass wir nicht mehr alle Sachen immer neu diskutieren müssen. Die Tendenz gab es früher. Jetzt sind da Werte festgeschrieben und wir können sie nutzen und einfordern in anderen Ämtern.“

Die Radwege an beiden Ufern des Rheins sind eine wichtige Nord-Süd-Achse im Bonner Radwegenetz.
Transparente Umsetzung
Viele Unterstützerinnen des Radentscheids stellen den städtischen Akteurinnen ihre eigene Expertise zur Verfügung. Hinter den einfachen Forderungen aus dem Bürgerbegehren stecken wohlüberlegte Ideen. Der Zeitraum von fünf Jahren ist aber nur bedingt realistisch, so das Team im Stadtplanungsamt. Im ersten Transparenzbericht, zur Umsetzung des Radentscheids, der im Mai veröffentlicht wurde, gibt die Stadt den Fortschritt an. 6,6 Kilometer neue Radwege sind seit dem Beschluss entstanden. Gefordert waren 15 pro Jahr. Ein aktualisierter Standard für Fahrradstraßen wurde auch erarbeitet. Dieser sieht eine neue Regelbreite von 4,5 Metern und deutlichere Markierungen vor. Bis Mai sind zudem rund 700 Fahrradstellplätze eingerichtet worden, unter anderem an 30 Mobilstationen. Ob das Tempo dieser Veränderungen hoch genug ist, ist streitbar. Die Bevölkerung scheint die gesteigerte Qualität laut dem Fahrradklimatest aber bereits wahrzunehmen. Mit dem im Mai veröffentlichten Bericht wurde zudem ein großer Schritt getan, ein Ziel des Radentscheids zu erreichen: Transparente Umsetzung. Andere Ziele erweisen sich als schwieriger. Sechs neu gestaltete Kreuzungen pro Jahr beziehungsweise 30 Kreuzungen in fünf Jahren fordert das Bürgerbegehren. Bisher ist noch keine Kreuzung umgestaltet worden.
„Wir sind in der Situation, wo es heißt: Es wird nur noch für den Radverkehr etwas getan in Bonn.“
Steffen Schneider, Radentscheid Bonn
Kommunikationsdesaster Rheinaue
In der jüngeren Vergangenheit hat sich auch die Verkehrssituation direkt am Rhein geändert. In Innenstadtnähe wurde eine neue Fahrradstraße eingeweiht. Der bisherige Radweg konnte zum Fußweg umgewidmet werden. Folgen Menschen dem Rhein Richtung Süden, gelangen sie in die Rheinaue, einen denkmalgeschützten Park, der zur Bundesgartenschau 1979 errichtet wurde. Besonders am Wochenende ist er voller Menschengruppen und dient im Sommer als Freiraum für Veranstaltungen. Planerisch ist dieses Areal eher kompliziert. Durch die Nähe zum Rhein und die besonders geschützten wassernahen Biotope müssen Eingriffe sorgfältig geplant sein.
Im Zuge des Projekts „Emissionsfreie Innenstadt“, gefördert durch den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) entglitt der Verwaltung dort die Kommunikation. In diesem Vorhaben sollten die Radrouten durch die Rheinauen attraktiver gestaltet und dafür verbreitert werden. Aktuell existieren dort zum Teil Zweirichtungsradwege mit lediglich rund zwei Metern Breite. Die Pläne schürten Angst vor überdimensionierten Radwegen und rasenden Radfahrerinnen, die die Aufenthaltsqualität verringern. „Kurz vor der Umsetzung gab es einen Riesenaufschrei. Dann haben sich der Naturschutzbeirat und die Bezirksregierung, die dort im Naturschutz mitbestimmt, eingeschaltet und gesagt ‚geht nicht‘“, erklärt Steffen Schneider. Das Projektvorhaben wurde zunächst gestoppt. Viele Falschbehauptungen, unter anderem zur Zahl der Bäume, die hätten gefällt werden müssen, prägten den Diskurs. Eine Bürgerbewegung war schnell dabei, auf einer eigenen Website Stimmung gegen das Projekt zu machen. Das Radverkehrsteam bedauert, damals noch nicht auf einer eigenen Website kommuniziert und aufgeklärt zu haben. Auch Bürgerbeteiligung hätte es an dieser Stelle gebraucht. Selbst Feinheiten können in der Kommunikation viel ausmachen, hat das Team inzwischen gelernt. Die Stadt vermeidet inzwischen den Begriff Radschnellweg, da dieser zu stark mit Autobahnen assoziiert werde. Radpendlerrouten, ein Begriff, der im Rhein-Sieg-Kreis verbreitet ist, sei hierfür besser geeignet.
Die Rheinaue auf der gegenüberliegenden Rheinseite wurde im Rahmen des EFRE-Projekts umgestaltet. Dort ist das Projekt gut angenommen worden. Es funktioniert und hat nicht den befürchteten Kahlschlag verursacht.
6,6 Kiometer
neuer Fahrradwege hat die Stadt seit dem Radentscheid umgesetzt.
Weitere 30 Kilometer sind bereits in Planung.


Breite Radwege wie hier auf der Oxfordstraße (oben) soll es perspektivisch überall in Bonn geben. Insgesamt steuert die Stadt außerdem auf 110 Fahrradstraßen zu.
Vierspurige Straßen sind selten
In Bonn gibt es auf beiden Seiten des Rheins Fahrradinfrastruktur, was den Fluss zu einer wichtigen Nord-Süd-Achse durch die Stadt macht. Das ist auch deshalb wichtig für die Stadt, weil es wenige breite Straßen gibt, wo sich die Bedingungen verändern lassen, ohne zumindest einspurig den Autoverkehr auszuschließen. „Wir haben fast keine vierspurigen Straßen. Diese simple Rechnung, eine Fahrspur umzuwandeln, das gibt es hier fast gar nicht“, erklärt Christina Welt aus dem Radverkehrs-Team. Eine Ausnahme ist die Adenauerallee, die parallel zum Rhein läuft und viele Kultureinrichtungen, aber auch Teile der Universität, eine Schule und diverse Arbeitgeber beherbergt. Die derzeit vierspurige Straße wird in den kommenden Monaten in einem Verkehrsversuch zweispurig für den Autoverkehr werden. Die Straße ist dadurch zum Politikum geworden. Im August dieses Jahres hat eine Bürgerbewegung eine äußere Spur mit Autos zugeparkt und so gegen die Pläne protestiert. Der Radentscheid hingegen sorgte mit einer temporären Protected Bike-Lane für Aufsehen. Steffen Schneider betrachtet den Konflikt mit Sorge.
Der Radentscheid sieht die Adenauerallee nicht als Hauptroute für das künftige Wegenetz an. Allerdings gäbe es dort viel Zielverkehr. Eine Autospur reiche vom Verkehrsaufkommen her aus. „Bei dem Aufkommen von Fahrradfahrenden und einer so wichtigen Straße geht es nach unserem Verständnis der geltenden Verordnungen gar nicht anders, als Radwege einzurichten, wenn man die Straße erneuert.“ Schneider wäre es aber lieber gewesen, wenn der Sanierungsbedarf auf der Adenauerallee erst in zehn Jahren entstanden wäre. Der Straßenquerschnitt gibt keine gute Radinfrastruktur her, ohne den Bordstein zu versetzen und gegebenenfalls sogar U-Bahn-Ausgänge anzugehen. An sich bietet er viel Platz, ein tiefgreifender Umbau wäre aber schwierig und teuer. Über den Protest scheint sich weder der Radentscheid noch das Radverkehrs-Team der Stadt zu wundern.

Viele Maßnahmen, wie hier auf der Viktoriabrücke sind zunächst nur gelb markiert worden. Sie tragen ihren Teil zum verbesserten Fahrradklima in Bonn bei.

Mit Ausnahme einiger Mobilstationen lassen die seit dem Radentscheid hinzugekommenen Abstellanlagen noch zu wünschen übrig.
Der große Wurf steht eigentlich noch aus
Der Widerstand zeigt gut, wo Verkehrsentwicklung und Radentscheid in Bonn aktuell stehen. Es gibt Zuspruch. Aber es besteht auch die Gefahr, mit dem Gefühl von Veränderung übers Ziel hinauszuschießen. Seit dem Radentscheid ist einiges passiert, die großen Würfe brauchen aber noch mehr Zeit, in der es darauf ankommt, den Rückhalt in der Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Bisherige Maßnahmen bauen inhaltlich vielfach auch noch auf anderen Beschlüssen auf.
Viele Fahrradstraßen, die in der jetzigen Legislaturperiode entstanden sind, basieren auf einem Verkehrsentwicklungsplan von 2010. Damals wurden viele Fahrradstraßen identifiziert, von denen rund ein Drittel umgesetzt, ein Drittel zurückgestellt und ein Drittel abgelehnt wurde. „Dieses zweite Drittel hat sich jetzt die Verwaltung vorgenommen, weil es dort schon Beschlüsse gab“, erklärt Schneider. Perspektivisch sollen es nun rund 110 Fahrradstraßen werden in Bonn, die zusätzlich rot markiert werden sollen.
Es sind aber nicht nur Low-Hanging-Fruits dieser Art, die die Fahrradstimmung in Bonn gesteigert haben. Das sei in großen Teilen auf das Mehr an Ressourcen zurückzuführen, das der Verwaltung seit der Annahme des Radentscheids finanziell und personell zur Verfügung steht, sagt das Radverkehrs-Team. Ein komplettes Wegenetz, das aus dem Verkehrs-entwicklungsplan weiterentwickelt wurde, befindet sich derzeit noch in der Abstimmung, soll in diesem Jahr aber endlich kommen. Enthalten soll es dann auch Radvorrangrouten, die gemeinsam mit dem Rhein-Sieg-Kreis erarbeitet wurden. „Ein verabschiedeter Fahrradnetzplan liegt bis heute noch nicht vor – nach über zwei Jahren Radentscheid. Dabei wäre er so wichtig, um bei Baumaßnahmen zu wissen, welche Bedeutung die jeweilige Route im Fahrradnetz hat“, erläutert Schneider. Die Stadt sei allerdings auch gut damit beschäftigt, bei Baustellen, die für eine Kanal- oder Fahrbahnsanierung entstehen, den Radverkehr mitzudenken, gibt Schneider zu. Hinzu kommt, dass Fachkräfte fehlen. Geld sei genug da und die Stellen geschaffen, erklärt er. Zum Teil ist es dennoch schwer, Planerinnen oder Ingenieurinnen zu finden. Man sehe schon Veränderung in der Stadt, aber vor allem an einem Leuchtturmprojekt, in Form von mehreren Kilometern zusammenhängender Vorzeigeinfrastruktur scheint es noch zu fehlen. Diese bräuchte es aber, um das Verständnis für den Radverkehr zu erhöhen. „Wir sind in der Situation, in der viele behaupten: Es wird in Bonn nur noch für den Radverkehr etwas getan. Nicht für den Autoverkehr – denn Autos will man angeblich aus der Stadt vertreiben – und auch nicht für den ÖPNV“, so Schneider. Dieses Gefühl sei tückisch, da noch viel Arbeit und Toleranz für die Veränderungsprozesse nötig sind, bis die Ziele des Radentscheids in greifbare Nähe gelangen. „Hier ein bisschen Fahrradstraße, da mal ein Stück Radweg, da mal ein Schutzstreifen: Das wird ja nicht als zusammenhängende Fahrradinfrastruktur wahrgenommen.“

Vier Fahrradparkhäuser mit insgesamt 280 Stellplätzen befinden sich gerade im Bau. Sie sollen Pendelverkehr und multimodalen Transport attraktiver machen, aber auch als Quartiersgarage dienen.
Die Highlights von morgen
Viele Maßnahmen, die mit diesem Beschluss zusammenhängen, stehen bereits in den Startlöchern. Und der Radentscheid habe in den Köpfen viel verändert, wenn es um die Vorstellung guter Fahrradinfrastruktur geht, meint Steffen Schneider. Auch Christina Welt ist positiv gestimmt: „Die Gesellschaft ist bereit, die Politik ist bereit und jetzt haben wir gerade auch die Ressourcen, die Sachen zu machen. Die wurden teilweise auch schon in der letzten Legislaturperiode vorbereitet und können jetzt umgesetzt werden.“ Wichtig sei natürlich, dass weiterhin politischer Wille für diese Prozesse gegeben ist.
Im Juni hat die Stadt bekannt gegeben, an vier Stellen vertikale Fahrradparkhäuser mit insgesamt 280 Stellplätzen zu bauen. Die Fundamente sind teilweise bereits gegossen. Als Standorte hat die Verwaltung zentrale Plätze in Bonn und den Bahnhof des rechtsrheinischen Stadtteils Beuel festgelegt. Während dort eher multimodale Pendlerinnen angesprochen werden sollen, dient der Turm am Frankenbadplatz in der Bonner Altstadt eher als Quartiersgarage. „Da haben wir super viele Beschwerden, dass Fahrräder geklaut und aufgestochen werden. Dort ist es dann fast eine Quartiersgarage für Fahrräder. Da gibt es diese alten Gründerzeithäuser mit abenteuerlichen Holztreppen. Da trägt man kein Fahrrad in den Keller“, erläutert Christina Welt. Felix Maus hat die Hoffnung, dass es solche Parkhäuser irgendwann an weiteren wichtigen Haltestellen des ÖPNV geben könnte. Erarbeitet wird auch eine Plattform, auf der Bürgerinnen Standorte für Fahrradständer empfehlen können.
Auch große Träume gibt es, etwa beim örtlichen ADFC oder dem Radentscheid-Team. Eine vierte Rheinbrücke für den Rad- und Fußverkehr könnte die durch den Rhein getrennten Stadtteile sehr gut miteinander verbinden. Eine rechtsrheinische Bahntrasse könnte die Verbindung noch als Radvorrangroute erweitern und selbst auswärts gelegene Stadtteile mit dem Zentrum zusammenbringen. Der ADFC NRW fordert, eine dazu beschlossene Machbarkeitsstudie möglichst schnell umzusetzen. An Projekten und Ideen mangelt es der Stadt nicht. Es bleibt abzuwarten, wie der gesellschaftliche Rückhalt für den Radentscheid sich entwickelt. Zumindest das Fahrradklima dürfte sich in den kommenden Jahren aber weiterhin verbessern.
Bilder: Stadt Bonn, Sebastian Gengenbach

 Stadt Bonn
Stadt Bonn UScale
UScale




 stock.adobe.com – Christian Müller
stock.adobe.com – Christian Müller



 Hase Bikes
Hase Bikes

 BVG
BVG
 stock.adobe.com – D. Ott
stock.adobe.com – D. Ott


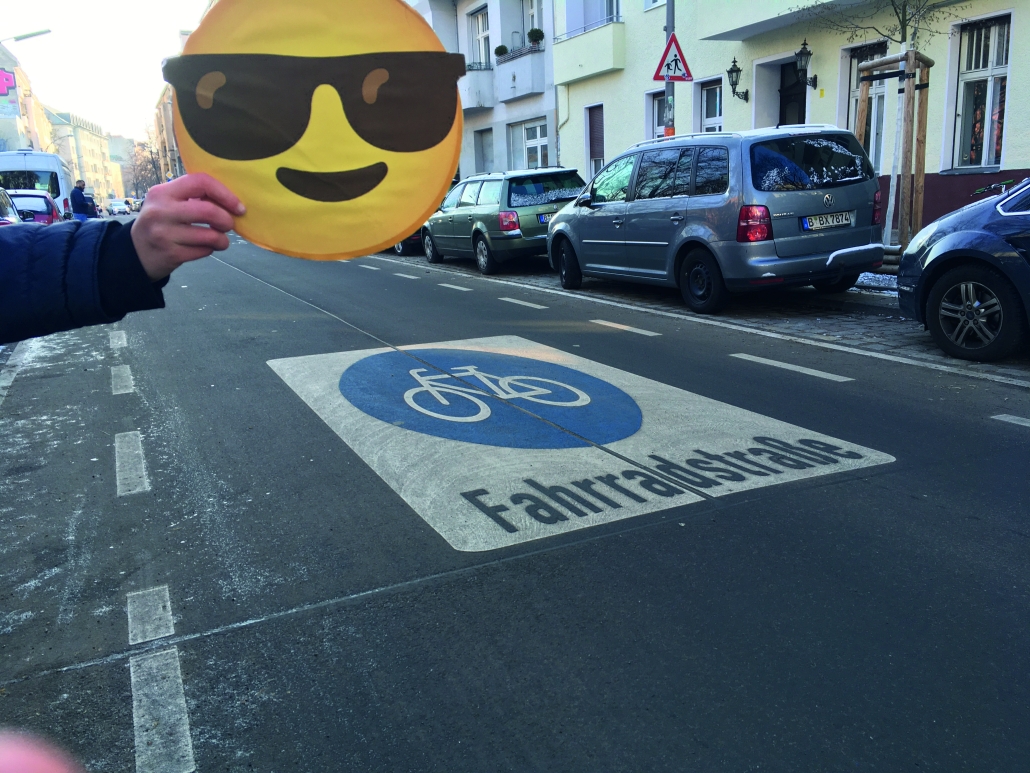
 SLA
SLA








 Reyer Boxem
Reyer Boxem








 Alexander Habermehl
Alexander Habermehl





