Im ehemals von der innerdeutschen Grenze getrennten Harz treffen noch immer drei Bundesländer aufeinander. Ein im EU-Programm Leader gefördertes Projekt zeigt, wie verschiedene Regionen für eine gemeinsame Sache zusammenkommen können. (erschienen in VELOPLAN, Nr. 03/2022, Sept. 2022)
Radfahren spielt im Harz bisher höchstens auf ausgewählten Mountainbike-Trails eine Rolle. Dominant sind in dem deutschen Mittelgebirge und seinem Umland der Ski- und Wandertourismus. Wie schafft man in so einer Region Motivation dafür, Radtourismus, Verleih- und Fahrradinfrastruktur zu fördern? Kurz gesagt braucht es einen ganzheitlichen Ansatz, der viele Projektpartner und -träger in einem Ziel gemein macht. „Wir wollten mehr, als ein paar Radwege zu schaffen oder zu beschildern“, beschreibt Mario Wermuth das Projekt Genuss-Bike-Paradies Harz/Braunschweiger Land, das er mitinitiiert hat.
Die Kooperation verbindet insgesamt acht Akteure, die über Regionen, Bundesländer und internationale Grenzen hinweg zusammenwirken und mit einem gemeinsamen Ziel die europäische Leader-Förderung (siehe Kasten auf Seite 68) in Anspruch nahmen. Dabei handelt es sich um drei Leader-Regionen aus Sachsen-Anhalt, drei Leader-Regionen und eine ILE-Region (Integrierte Ländliche Entwicklung) aus Niedersachsen und eine österreichische Leader-Region, das Südburgenland.


Die Grundidee des Genuss-Bike-Paradieses lautet, dass der E-Bike-Tourismus für den Harz und das Braunschweiger Land ein großes ungenutztes Potenzial birgt. Die Touren verbinden kulinarische und kulturelle Highlights mit Ladeinfrastruktur und Gaststätten.
Genuss und Fahrrad kombinieren
Weil das Südburgenland als Partner der gemeinsamen Tourismusmarke E-Bike-Paradies involviert ist, ist die Kooperation transnational. Die Idee, Genuss und Fahrrad miteinander zu kombinieren, wird dort schon länger praktiziert. An einen Austausch-Besuch 2019 erinnert sich Mario Wermuth gut. Unter anderem war die deutsche Delegation auf einem Weingut zu Gast, auf dem der gemeinschaftliche Gedanke spürbar wurde. „Da waren dann auch andere Winzer, die ihren Wein ausgeschenkt haben“, erzählt Wermuth.
Solche Erfahrungen mit dem Aufbau eines „E-Bike-Paradieses“ im Südburgenland sollten auf den Harz übertragen werden. Im Gegenzug ist geplant, die Erfahrungen mit dem Belohnungssystem der Harzer Wandernadel für das E-Bike-Paradies im Südburgenland nutzbar zu machen.
Im Südburgenland tritt der gleichnamige Verein als Projektträger auf. Eine solche Verantwortungsstruktur brauchte es auch in den anderen Regionen. Dafür sind Organisationen unterschiedlicher Art zusammengekommen, etwa der Landkreis Goslar oder die Gemeinde Huy in Sachsen-Anhalt. Für die Leader-Region Harz ist das E-Bike-Verleih-Unternehmen HarzMobil zuständig, das Mario Wermuth gemeinsam mit Alexander Waturandang verantwortet. Sie gaben den ersten Impuls für das regionsübergreifende Vorhaben.
„Mein ursprünglicher Anlass, das Ganze zu machen, war, den Harz als E-Bike-Region bekannt zu machen und alle lokalen Betriebe zusammenzubringen, die am E-Bike-Tourismus interessiert sind“, schildert Wermuth. Eine Erhebung hatte ergeben, dass die durchschnittlichen Tourist*innen durchaus mehrere Übernachtungen in der Region verbringen. Diese Zeit füllen sie mit unterschiedlichen Aktivitäten. Fahrradfahren spielte im Harz gegenüber dem Wandern und Skifahren bisher jedoch eine untergeordnete Rolle, so die Wahrnehmung. Wenn überhaupt, geschehen die Buchungen für Fahrräder spontan und für kurze Dauer. Um neben den anderen Freizeitaktivitäten nicht unterzugehen, müsste man den Harz für E-Bikes aufbereiten, überlegte Alexander Waturandang 2016. Die Idee war sicher nicht völlig selbstlos. Der E-Bike-Verleiher HarzMobil betreibt insgesamt fünf Stationen, Waturandang ist zudem Inhaber des Fahrradladens Bike and Barbecue in Hornburg.
Bike-Paradies bringt lokale Wirtschaft zusammen
Das Genuss-Bike-Paradies umfasst 14 Sterntouren und einen mehrtägigen Rundweg, dessen Etappen zwischen 24 und 65 Kilometern messen. Sie verlaufen auf bereits bestehenden Radwegen und verbinden verschiedene Points, aber auch Service-Punkte und Ladeinfrastruktur. Waturandangs Fahrradgeschäft wurde letztendlich nur über eine Sterntour in das Streckennetz eingefügt. Die Region nördliches Harzvorland, in der Hornburg liegt, ließ sich nicht für das Vorhaben gewinnen.
Fahrradvermieter sind nicht die einzigen Unternehmen, an denen die Routen vorbeiführen. Über die Website www.genuss-bike-paradies.com lassen sich auch Unterkünfte finden. Zudem können Touristinnen über den Reiter Arrangements ganze Leistungspakete buchen. Die Strecken verlaufen entlang diverser Einkehrmöglichkeiten und kultureller Highlights, darunter eine Glasmanufaktur in Derenburg und ein Brauhaus in Quedlinburg. Über die auf Outdoor-active-Karten basierende App können die E-Bikerinnen diese Points of Interest (POI) schnell ausfindig machen und ansteuern.
Als Zielgruppe insbesondere Radfahrende mit elektrischer Unterstützung anzusprechen, mag heute nicht mehr ungewöhnlich erscheinen. Als Wermuth und Waturandang vor rund sechs Jahren anfingen, die Projektidee zu entwickeln, war dieser Ansatz allerdings noch durchaus bemerkenswert. „Da brauchte man etwas Weitblick, um da mitzumachen“, ordnet Waturandang die Anfänge ein. Der offizielle Startschuss des Projekts fiel 2020. Die Formalitäten, die die Leader-Förderung mit sich brachte, bremsten die Geschwindigkeit des Vorhabens. „Wir hätten gerne schon zwei Jahre früher begonnen“, so Wermuth. Ende Juni dieses Jahres ist zumindest die Förderung ausgelaufen und das Entstandene mit einer Abschlussveranstaltung gefeiert worden.
Vereint entgegen dem historischen Trend
Grund zu feiern hatten die Projektpartner auch deshalb, weil die grenzübergreifende Zusammenarbeit für den Harz einen besonderen Wert hat. In der deutschen Raumordnung und Geschichte ist das Mittelgebirge und dessen Vorland etwa durch die ehemalige Grenze zwischen der DDR und der BRD zerrissen worden. Auch heute zeigt beispielhaft der Dreiländerstein südlich von Benneckenstein, dass im Harz die Grenzen zwischen Sachsen-Anhalt, Thüringen und Niedersachsen aufeinandertreffen. Das kann auch Radtourist*innen vor Schwierigkeiten stellen, wenn eine bestimmte Beschilderung beim Überschreiten der Ländergrenze einfach aufhört.
So viele durch den Harz und das Braunschweiger Land verbundene Akteure an einen Tisch zu bringen, brachte dem Vorhaben aber nicht nur Vorteile. Es bedurfte und bedarf einer intensiven Abstimmung, weil die Projektziele der einzelnen Träger sehr individuell sind und erst auf einen Nenner gebracht werden müssen, so ein Learning des Genuss-Bike-Paradieses.
Was zunächst nach viel Koordinationsarbeit klingt, soll am Ende allen Beteiligten einen Skalierungsvorteil bringen, erklärt Waturandang. Nur in einer größeren Gemeinschaft können Projekte wie das im Harz und Braunschweiger Land gut funktionieren. Er zieht den Vergleich zu einem Kneipenviertel. Eine einzelne Kneipe in einer willkürlichen Straße zieht kaum Menschen an. Wenn sich allerdings ein ganzes Viertel entwickelt, in dem es viele Gaststätten gibt, ist die Attraktivität höher. Indem die einzelnen Regionen für das Genuss-Bike-Paradies an einem Strang ziehen, nehmen die Menschen sie von außen als Einheit wahr und sie können besser mit anderen Regionen oder Freizeitaktivitäten konkurrieren.
Pandemie hat dem Projekt nicht geschadet
Fast schon ironisch scheint es da, dass die Projektpartner aufgrund der Pandemie nicht in körperlicher Präsenz zusammenarbeiten konnten. Online-Veranstaltungen, in denen das Projekt vorgestellt wurde, erwiesen sich rückblickend eher als Vorteil und stießen auf großes Interesse seitens der lokalen Unternehmen. Rund 120 interessierte Unternehmen wollen bereits mitwirken, viele von ihnen haben eine entsprechende Vereinbarung schon unterzeichnet. Die Betriebe wurden im Hinblick auf die Bedürfnisse von E-Biker*innen qualifiziert.
Viele Akteure zu vereinen, war im Fall Genuss-Bike-Paradies auch vorteilhaft, weil das Projekt damit einen Grundgedanken des Leader-Programms verfolgte und förderfähig war. Im Rahmen des Förderprogramms verantworteten die einzelnen Träger verschiedene Aufgaben, die externe Dienstleister dann umsetzten. HarzMobil übernahm das Social-Media-Management und entwickelte ein Stempelsystem, das dazu anregen soll, das Genuss-Bike-Paradies möglichst vollumfänglich zu bereisen. Andere Akteure planten etwa die Touren oder entwickelten Marketing- und Vertriebskonzepte.
Ein richtiges Resümee zum Projekterfolg lässt sich noch nicht ziehen, auch wenn erste Vorzeichen gut aussehen. „Wir merken auf jeden Fall, dass immer mehr Leute diese Touren abfahren“, verrät Alexander Waturandang. Vor ein paar Wochen sind auch Broschüren und Karten gedruckt und verteilt worden.
„Wir wollten mehr, als ein paar Radwege zu schaffen oder zu beschildern“
Mario Wermuth, HarzMobil

Es bleibt viel zu tun
An einer Perspektive, was das Genuss-Bike-Paradies langfristig sein und leisten kann, mangelt es den Verantwortlichen nicht. Die Touren sollen erweitert und neue Arrangements entwickelt werden. Das Marketing fokussiert bereits die nächste Saison, dort soll die E-Bike-Region richtig wirksam werden.
Mit Blick auf die Zukunft und die nun ausgelaufene Förderung müssen die Projektpartner außerdem die Organisationsstruktur auf neue Fundamente stellen. Die Hotels, deren Zimmer und Angebote über die neue Website buchbar sind, nutzen diesen Service bisher kostenlos. In Zukunft sollen sie einen Mitgliedsbeitrag zahlen, als Gegenleistung für die prominente Online-Darstellung. Geplant ist weiterhin, einen Verein zu gründen, in dem sich die Mitgliedsbetriebe dann organisieren können und der die bisher vom Harz-Tourismus-Verband verantwortete Website betreiben soll.
Man müsse solche Projekte einfach angehen, anstatt vor den Formalien zurückzuschrecken, rät Wermuth anderen Regionen. Die Chancen übersteigen schließlich den Aufwand.
Die Projektinitiatorinnen benötigen ein gewisses Durchhaltevermögen, müssen hinter der Idee stehen und auch bereit sein, diese auch nach außen zu repräsentieren. Und die Protagonistinnen sollten, wenn möglich, nicht allein agieren. Die Vorteile der Gemeinschaft scheinen also auf allen Handlungsebenen relevant zu sein.

LEADER-Programm:
Das Akronym LEADER steht ins Deutsche übersetzt für „Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft“. Dabei handelt es sich um ein Maßnahmenprogramm der Europäischen Union, das aus dem Landwirtschaftsfonds ELER finanziert und mit Mitteln der Länder, des Bundes und der Kommunen aufgestockt wird. Dass sich, wie im Falle des Genuss-Bike-Paradieses mehrere Akteure zusammentun, ist Teil des Konzepts, seit es 1991 eingeführt wurde. In den derzeit 321 deutschen LEADER-Regionen des bis Ende 2022 laufenden Förderzeitraums erarbeiten lokale Aktionsgruppen vielfältige Entwicklungskonzepte.
Mehr Infos unter:
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld_de
Bilder: Openstreetmap – Schmidt-Buch-Verlag, L. Weber, DVS

 Openstreetmap – Schmidt-Buch-Verlag
Openstreetmap – Schmidt-Buch-Verlag foto@bopicture.de
foto@bopicture.de



 Stefan Kuhn Photography
Stefan Kuhn Photography

 Andreas Meyer
Andreas Meyer

 stock.adobe.com - Katja Xenikis
stock.adobe.com - Katja Xenikis




 stock.adobe.com - Uwe
stock.adobe.com - Uwe






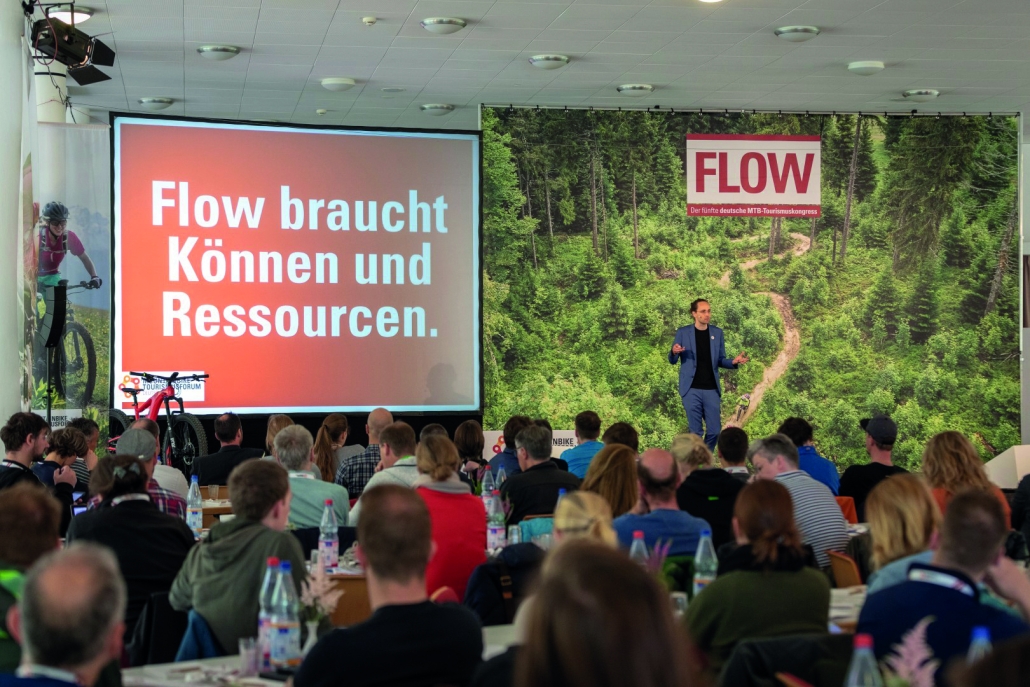



 stock.adobe.com - Peeradontax
stock.adobe.com - Peeradontax


 Gunnar Fehlau
Gunnar Fehlau






 stock.adobe.com - hkama
stock.adobe.com - hkama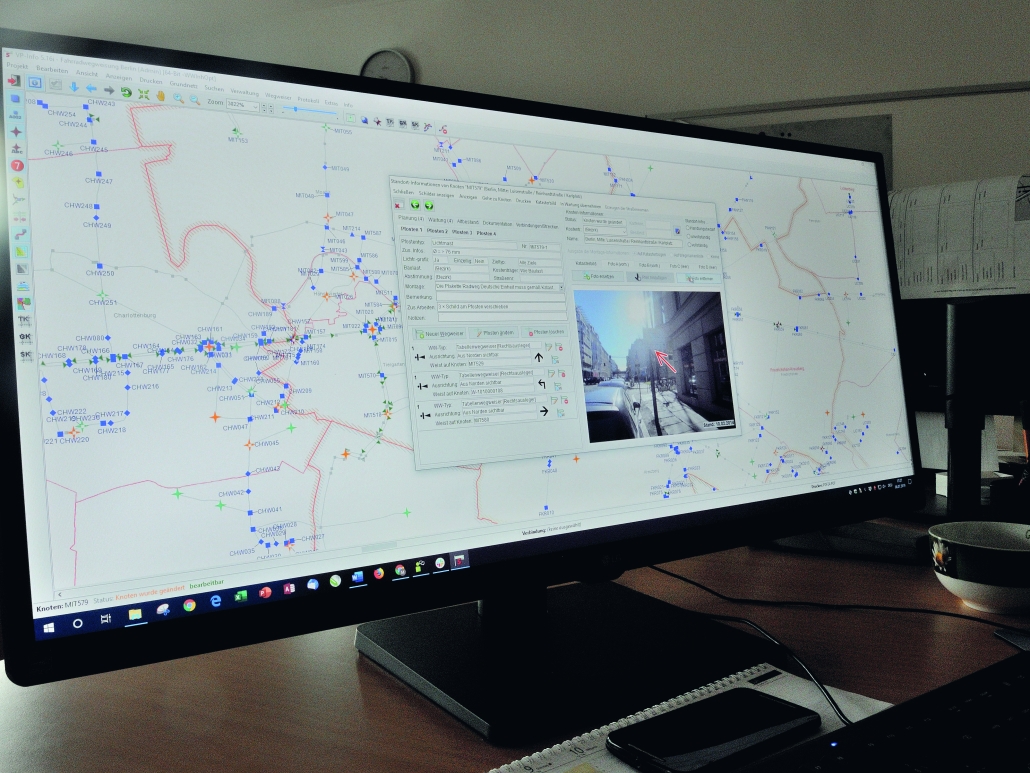

 Mailin Busko / Rad und Tour
Mailin Busko / Rad und Tour