Das Jahrhunderthochwasser hat vor zwei Jahren weite Teile der Stadt Stolberg bei Aachen zerstört. Beim Wiederaufbau will die Stadtregierung nun die Mobilität in der zerstörten Region neu ordnen. Stolberg soll zur Stadt der kurzen Wege werden. Ein Ortsbesuch. (erschienen in VELOPLAN, Nr. 03/2023, September 2023)
Der Baulärm ist in Stolberg allgegenwärtig. Am Mühlener Bahnhof im Stadtzentrum sanieren Bauarbeiter den Parkplatz und rütteln Pflastersteine ins Sandbett. In der nahe gelegenen Geschäftsstraße wird hinter vielen der verbarrikadierten Fensterfronten gebohrt und gesägt, und in der angrenzenden Fußgängerzone reißen Bagger die Straße auf, um neue Leitungen für Strom, Gas und Wasser im Erdreich zu verlegen.
Seit zwei Jahren leben die Menschen in Stolberg, rund 15 Kilometer westlich von Aachen gelegen, auf einer riesigen Baustelle. Wann sämtliche Schäden behoben sind, ist nicht absehbar. Im Sommer 2021 hatte das Jahrhunderthochwasser die Talachse der Kupferstadt mit voller Wucht getroffen. Im Süden überschwemmte die braune Brühe zunächst die Produktionsmaschinen in den Industriebetrieben. Weiter flussabwärts walzte sie mit jeder Menge Unrat durch die frisch renovierte Fußgängerzone, setzte dort das Rathaus unter Wasser und breitete sich Stunde um Stunde in den umliegenden Straßen aus. Bis auf drei Meter Höhe türmte sich die Wassermasse an den Hausfassaden und riss alles mit, was sich ihr in den Weg stellte. Sie unterspülte die Asphaltdecke und verdrehte sie wie einen Hefezopf. Sie zerstörte Brückenpfeiler und riss Krater in Schwimmbadgröße in die Straßen. Nahezu alle Wohnungen und Geschäfte im Erdgeschoss der Talachse, dem Herzstück der Stadt, wurden geflutet.
„Das Ausmaß der Zerstörung war unglaublich“, sagt Bürgermeister Patrick Haas. Als er jedoch inmitten der Trümmer mit den Rettungskräften und den Anwohnern sprach, stand schnell für ihn fest: Ein Wiederaufbau allein reicht nicht aus. „Wir müssen die Katastrophe als Chance nutzen“, sagt er. Die Menschen brauchen eine Perspektive, um in Stolberg zu bleiben. Die will er ihnen geben, indem er in seiner Stadt so viel Klimaschutz, Klimaanpassung und nachhaltige Mobilität umsetzt wie möglich. Stolberg soll zu einer Stadt der kurzen Wege werden. Der Arbeitsaufwand dafür ist immens. Statt nur die alte Infrastruktur wiederherzustellen, arbeitet das Team um den Mobilitätsmanager der Stadt, Georg Trocha, mit Hochdruck daran, die öffentlichen Flächen in der Talachse, der Hauptschlagader der Kernstadt, neu aufzuteilen. Sie legen im „Verkehrskonzept Talachse“ für jeden Streckenabschnitt fest, welche primären Ziele sie erfüllen soll, also ob der Bus-, Rad-, Fuß- oder Autoverkehr dort bevorzugt wird. Außerdem kooperieren sie mit den Unternehmen in den Gewerbegebieten, um den Mitarbeiterinnen fürs Pendeln eine Alternative zum Privatwagen anzubieten.


In der Fußgängerzone werden noch neue Versorgungsleitungen verlegt. Aber der Neuanfang ist gemacht: Die Goldschmiede ist geöffnet.
Vorgeschichte ohne Katastrophe
Der Entschluss des Bürgermeisters, die Mobilität in der Talachse neu zu ordnen, hat eine Vorgeschichte, die schon vor der Flutkatastrophe beginnt. Auf seine Initiative hin hatte die Stadtregierung bereits 2018 das „Klimafreundliche Mobilitätskonzept“ beschlossen. Stolberg brauchte damals dringend eine Alternative zum Auto im Alltag. Etwa ein Drittel der Treibhausemissionen, die vor Ort produziert werden, verursacht der Autoverkehr. Das ist ein typischer Wert für ländliche Regionen, aber viel im Bundesdurchschnitt, wo der Wert mit rund 20 Prozent deutlich niedriger liegt. In Stolberg war zu diesem Zeitpunkt ein umweltgerechter Umbau nicht möglich, weil der Stadtrat bereits 2015 die Pläne für den Umbau der Talachse beschlossen hatte. Diese wurden 2019 umgesetzt. Nach der Flut gab das Mobilitätskonzept Haas den notwendigen Rückenwind, um in der Talachse den Rad- und Busverkehr zu stärken.
Die Rahmenbedingungen für den Umstieg auf den Umweltverbund sind gut. Die 60.000-Einwohner-Stadt ist an ein attraktives Schienennetz angebunden. Vom Hauptbahnhof am Stadtrand fährt bis zu viermal pro Stunde ein Regionalexpress Richtung Aachen oder Köln. Die Euregio-Bahn verbindet die Stadt zudem mit dem Umland und den Niederlanden und hält viermal im Stadtgebiet. Was den Pendlerinnen und Stadtbewohnerinnen bislang fehlte, war ein attraktives Stadtbussystem sowie eine Radinfrastruktur, auf der die Menschen sicher und bequem durch die Stadt oder zu den Bus- und Bahnhaltestellen radeln können.
Der Platz für mehr Radwege und neue Buslinien, die die Wohngebiete passieren, soll von den bisherigen Flächen für den Autoverkehr kommen. Damit das klappt, muss insbesondere das Parken neu geordnet werden. „Die Autos sollen in der Kernstadt nicht mehr überall am Fahrbahnrand abgestellt werden, sondern nur noch dezentral in Parkhäusern, Park&Ride-Stellplätzen oder auf neuen Sammelparkplätzen, die wir bauen werden“, sagt Haas. Die Idee ist, dass alle Autofahrenden in der Talachse dennoch im Umkreis von 150 bis 200 Meter einen Parkplatz finden. Sind die Wohnstraßen erst mal von geparkten Autos am Fahrbahnrand befreit, könnten dort neue Stadtbuslinien verkehren. Bislang scheiterten diese aufgrund des ruhenden Verkehrs an zu schmalen Fahrspuren und zu engen Kurven.

„Mir ist es lieber, nur drei Routen in Gänze zu bauen, als einen Flickenteppich zu produzieren.“
Georg Trocha
Mobilitätsmanager der Stadt Stolberg
Durchgehende Radroute statt Flickenteppich
Der gewonnene Platz soll auch für breitere Gehwege und neue Radwege genutzt werden. Radstreifen, separate Radwege oder Fahrradstraßen sind in Stolberg bislang die seltene Ausnahme. Das spiegelt auch das Mobilitätsverhalten der Anwohnenden wider. Nur magere drei Prozent der Wege wurden laut letzter Mobilitätsbefragung 2016 mit dem Rad zurückgelegt. „Mittlerweile sind es zwar deutlich mehr, aber wir stehen beim Ausbau des Radverkehrs noch am Anfang“, sagt Trocha.
Vor drei Jahren wurde ein Radverkehrsplaner eingestellt, der das bereits 2018 skizzierte gesamtstädtische Routennetz mit 18 Hauptrouten schrittweise umsetzen soll. „Das sind die wichtigsten Verbindungen für Radfahrer, um durch die Stadt zu kommen“, sagt Trocha. Sein Anspruch ist, jede dieser Routen stets komplett fertigzustellen. „Mir ist es lieber, nur drei Routen in Gänze zu bauen, als einen Flickenteppich zu produzieren. Schließlich wollen wir die Menschen aufs Rad bringen“, sagt er.
Eine der wichtigsten Verbindungen ist die Radroute, die in der Talachse parallel zum Fluss Vicht verläuft. Über eine Länge von rund sieben Kilometer verbindet sie die Industriestandorte am Stadtrand mit der Altstadt, den Geschäftsstraßen und dem Mühlener Bahnhof im Zentrum der Kupferstadt und führt dann weiter bis zum Hauptbahnhof am anderen Ende der Stadt. Diese Route ist für die Pendlerinnen, Anwohnerinnen attraktiv und sogar für Tourist*innen. Denn sie führt mitten durch die Fußgängerzone. Von dort sind es nur wenige Schritte hoch in die Altstadt mit ihren pittoresken Gässchen bis zur mittelalterlichen Burg.

Wenn alles nach Plan geht, wird in den kommenden Wochen der Gehweg um einen zweieinhalb Meter breiten Radweg erweitert.
Zweirichtungsradweg für die Talachse
In der Fußgängerzone unterhalb der Burg hat die Flut besonders gewütet. Als das Wasser abfloss, türmten sich dort bis auf Brusthöhe Tische, Stühle, Bretter und sonstiges Treibgut aus Holz, Metall und Plastik. Heute ist davon zwischen Geschenkladen und Goldschmiede nichts mehr zu sehen. Bunte Windspiele, Blumenkübel und kleinen Aufsteller locken die Pas-santinnen in die Läden. Aber weiterhin sind viele der umliegenden Ladenlokale verwaist. Ihre Schaufenster sind verbarrikadiert und dokumentieren mit frontfüllenden Fotos die Flutschäden. Dieser Teil der Talachse ist ein Lichtblick für die Stadtbewohn-erinnen. Seit dem Frühling verlegen hier Bauarbeiter Versorgungsleitungen im Erdreich. „Wenn die Fußgängerzone im Anschluss neu gepflastert wird, bekommt sie in der Mitte einen drei Meter breiten Zweirichtungsradweg“, sagt Haas und schiebt sein Gravelbike an Bagger und Baustellenbaken vorbei. Wenn alles nach Plan geht, wird das Teilstück der Radroute gegen Ende des Sommers fertig sein.
Im weiteren Verlauf des Tals wird die Fortsetzung des Zweirichtungsradwegs derzeit geplant. In der angrenzenden Rathausstraße gilt zwar bereits Tempo 30. Allerdings animiert die schnurgerade Straße Autofahrende dazu, deutlich schneller zu fahren. Zwischen den abgestellten Pkw am Fahrbahnrand und drängelnden Fahrzeugen am Hinterrad ist Radfahren dort momentan nur für hart gesottene Fahrradfahrende alltagstauglich. Wie die Flächen dort künftig verteilt werden sollen, diskutieren die Ratsmitglieder in den kommenden Wochen.
Auf dem letzten Drittel der Strecke Richtung Bahnhof ist die Planung schon deutlich weiter vorangeschritten. Noch in diesem Jahr soll der vorhandene Gehweg um einen rund zweieinhalb Meter breiten Zweirichtungsradweg erweitert werden. „Für die Radfahrer ist das ein echter Gewinn“, sagt Trocha. Vor der Flut mussten sie sich hier ebenfalls mit den Autofahrenden die Fahrspur teilen.
Der Zeitdruck für die Feinplanung der Teilabschnitte, der übrigen Routen und ihre Umsetzung ist immens. „Wir müssen viele große Projekte in kurzer Zeit planen und fertigstellen“, sagt Trocha. Für das kleine Team ist das ein Kraftakt, aber zugleich die einmalige Gelegenheit, die Alltagsmobilität in Stolberg in kurzer Zeit spürbar zu verändern. In der Regel können Planer*innen in ihrem Arbeitsleben stets nur einzelne Bereiche eines Stadtteils umplanen. „Wir dagegen bauen die gesamte Talachse um“, sagt der Mobilitätsmanager. Hilfreich ist, dass der Ausbau des Radverkehrs schon seit Jahren vorbereitet wurde.
Ein Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof
Auf dem Bahnhofsvorplatz zeigt sich, wie Bürgermeister und Mobilitätsmanager den Radverkehr schon lange auf Zuwachs planen. Eine große Zahl überdachter Stellplätze und 36 abschließbare Fahrradboxen stehen hier zwischen Parkplatz und Bahnsteig. „Sämtliche Boxen sind vermietet und rund zwei Dutzend Radfahrer stehen auf der Warteliste“, sagt Trocha. Mit diesem Bedarf hatte bei der Fertigstellung 2016 noch niemand gerechnet. „Damals standen gerade mal zehn Räder am Bahnhof.“ Trotzdem ließ die Stadt im Rahmen eines Förderprojekts 16 Fahrradboxen neben den Gleisen aufstellen. Als die Nachfrage hoch blieb, sorgten weitere Förderprogramme für Nachschub. Der stetig steigende Bedarf an sicheren Abstellplätzen ist für Trocha ein wichtiges Signal Richtung Stadtrat: „Diese Entwicklung beweist, dass die Infrastruktur, die wir bauen, immer auch eine Nachfrage erzeugt“, sagt er. Der nächste Schritt ist bereits gemacht. Im kommenden Jahr soll am Bahnhof ein Fahrradparkhaus mit 100 Stellplätzen entstehen.
Viele ihrer Mobilitätsideen setzen Patrick Haas und Georg Trocha selbst auch im eigenen Alltag um. „Ich habe drei Kinder, trotzdem haben meine Frau und ich ‚nur‘ ein Auto, das ist selten in unserer Region“, sagt Bürgermeister Haas. Er nutzt den Wagen werktags kaum, sondern fährt mit seinem Gravelbike ins Büro und zu all seinen Terminen. Obwohl die Region bergig ist und die Anstiege mit bis zu zehn Prozent Steigung immer wieder knackig. Trocha nimmt für seine Termine lieber ein E-Bike aus der Dienstfahrzeug-Flotte. „Mit Motorunterstützung ist Radfahren selbst in Stolberg fast für jedermann möglich“, sagt er.


Sichere Radabstellanlagen gibt es in Stolberg sowohl am Mühlener Bahnhof in der Stadt (links) als auch am Hauptbahnhof am Stadtrand (rechts)
Mit Unternehmen autoarme Mobilität fördern
Dass Stolberg Alternativen zum Privatwagen für die Alltagswege braucht, finden mittlerweile auch einige der lokalen Unternehmen. „Junge Ingenieure aus Aachen oder Düren fragen deutlich seltener nach einem Dienstwagen als noch vor zehn Jahren“, sagt Trocha. Vielmehr wollen sie diese Strecken per Bus, Bahn und Rad zurücklegen. Das berichten ihm ortsansässige Arbeitgeber. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, brauchen sie Alternativen zum Auto. Trocha reagiert darauf. Im kommenden Jahr startet er mit 16 Arbeitgebern aus Stolberg ein Projekt im Rahmen von „ways2work“.
Diesen Wettbewerb hat die Landesregierung Nordrhein-Westfalen initiiert. Die Aufgabe ist, autoarme Mobilität auch in ländlichen abgelegenen Gewerbegebieten umzusetzen. Stolberg ist eine von 15 Kommunen, deren Projektidee gefördert wird. Diese sieht vor, dass ab 2024 eine neue Stadtbuslinie nebst Rufbusverkehr vier Gewerbegebiete ans ÖPNV-Netz anbindet. Außerdem werden an den Unternehmensstandorten und im Stadtgebiet Sharing-Stationen für E-Bikes installiert. An der Umsetzung ist neben der Stadt Stolberg das regionale Verkehrsunternehmen ASEAG beteiligt und der Bike-Sharing-Anbieter Velocity Aachen.
Für die Arbeitgeber ist das Risiko gering. „Die Unternehmen zahlen für die Station mit sechs E-Bikes an ihrem Standort einen Eigenanteil von 8000 Euro“, sagt Trocha. Bei Bedarf kann die Flotte auch auf 12 oder 18 Räder erweitert werden. Die Resonanz bei den Unternehmen ist hoch. Anfang August waren 16 Arbeitgeber mit rund 1900 Mitarbeitern in Stolberg bei „ways2work“ dabei, Tendenz weiterhin steigend.

„Die Autos sollen in der Kernstadt nicht mehr überall am Fahrbahnrand abgestellt werden, sondern nur noch dezentral.“
Patrick Haas
Bürgermeister der Stadt Stolberg
Stadtbus im 15-Minuten-Takt
Die Mobilitätsstationen, die neue Buslinie und das Rufbussystem sind ein Vorgeschmack auf das neue Stadtbussystem, das die Stadtregierung in ein paar Jahren in der Kernstadt ausrollen will. Die neuen Linien sollen nicht mehr ausschließlich auf den Hauptstraßen unterwegs sein, sondern in die Wohnstraßen hineinfahren und dort in kurzen Abständen halten. Der Fußweg zur nächsten Haltestelle soll maximal 150 Meter betragen. „Momentan sind die Haltestellen oft 400, 600 oder 800 Meter entfernt und haben eine Steigung von zehn Prozent, das ist unattraktiv“, sagt Trocha. Acht Stadtbuslinien soll es geben, die im 15-Minuten-Takt zwischen 5 und 23 Uhr die einzelnen Haltestellen ansteuern. „Das Wichtigste ist der Takt, Takt, Takt!“, sagt Haas. Nur wenn die Menschen keinen Fahrplan benötigten und sich auf kurze Wartezeiten verlassen könnten, steigen sie um, sagt er. „Entscheidend ist, dass alle Busse gleichzeitig am Stadtbahnhof, dem Mühlener Bahnhof, ankommen und die Busse auch gleichzeitig abfahren“, sagt Trocha. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass jeder Fahrgast jeden Bus erreicht.
Bus und Bahn als Rückgrat für Alltagsmobilität
„Für uns sind der Bus und die Regionalbahn das Rückgrat der Alltagsmobilität“, sagt Trocha. Deshalb haben sie künftig Vorfahrt, vor dem Radverkehr und dem Autoverkehr. „Damit die Busse in die Wohngebiete überhaupt hineinfahren können, muss das Parken am Fahrbahnrand in den engen Straßen teilweise jedoch neu strukturiert werden“, sagt er. Im Frühjahr wurden in Stolberg bereits die potenziellen Routen abgefahren und angepasst. In den kommenden Wochen entscheidet der Stadtrat über die Pläne.
Der Ausbau des Stadtbussystems ist wie der Ausbau des Radverkehrs ein Projekt für die nächsten Jahrzehnte. Läuft alles nach Zeitplan, könnten laut Trocha zwei Buslinien im Jahr 2025 starten, sofern die Landesregierung die Finanzierung übernimmt.
Die Aufgaben in Stolberg sind riesig, der Kraft- und Arbeitsaufwand immens. Sämtliche Ratsmitglieder arbeiten ehrenamtlich. In den kommenden Monaten stellen sie die Weichen, wie sie und ihre Enkel zukünftig mobil sein werden. Wenn sie ihre aktuellen Vorhaben umsetzen, kann Stolberg in den kommenden Jahren zum Vorreiter werden und zeigen, wie eine nachhaltige Alltagsmobilität in ländlichen Kommunen aussehen kann. Bei allen Vorhaben sitzt dem Team um Haas und Trocha die Zeit im Nacken. Der Wiederaufbaufonds der Landesregierung und des Bundes ist momentan bis 2030 begrenzt.
Der Umbau der Mobilität ist dabei längst nicht die einzige Herausforderung. Gegen eine weitere Jahrhundertflut werden all die neuen Maßnahmen nichts ausrichten können. Das weiß Haas genau. „Das Wasser muss zukünftig weit vor unserer Stadt aufgehalten werden“, sagt der Bürgermeister. Ideen für große Rückhaltebecken inmitten grüner Wiesen weit vor der Stadt existieren bereits, die Pläne dafür sind noch nicht verabschiedet.
Bilder: Stadt Stolberg, Georg Trocha, Andrea Reidl

 Stadt Stolberg
Stadt Stolberg Andreas Lörcher
Andreas Lörcher





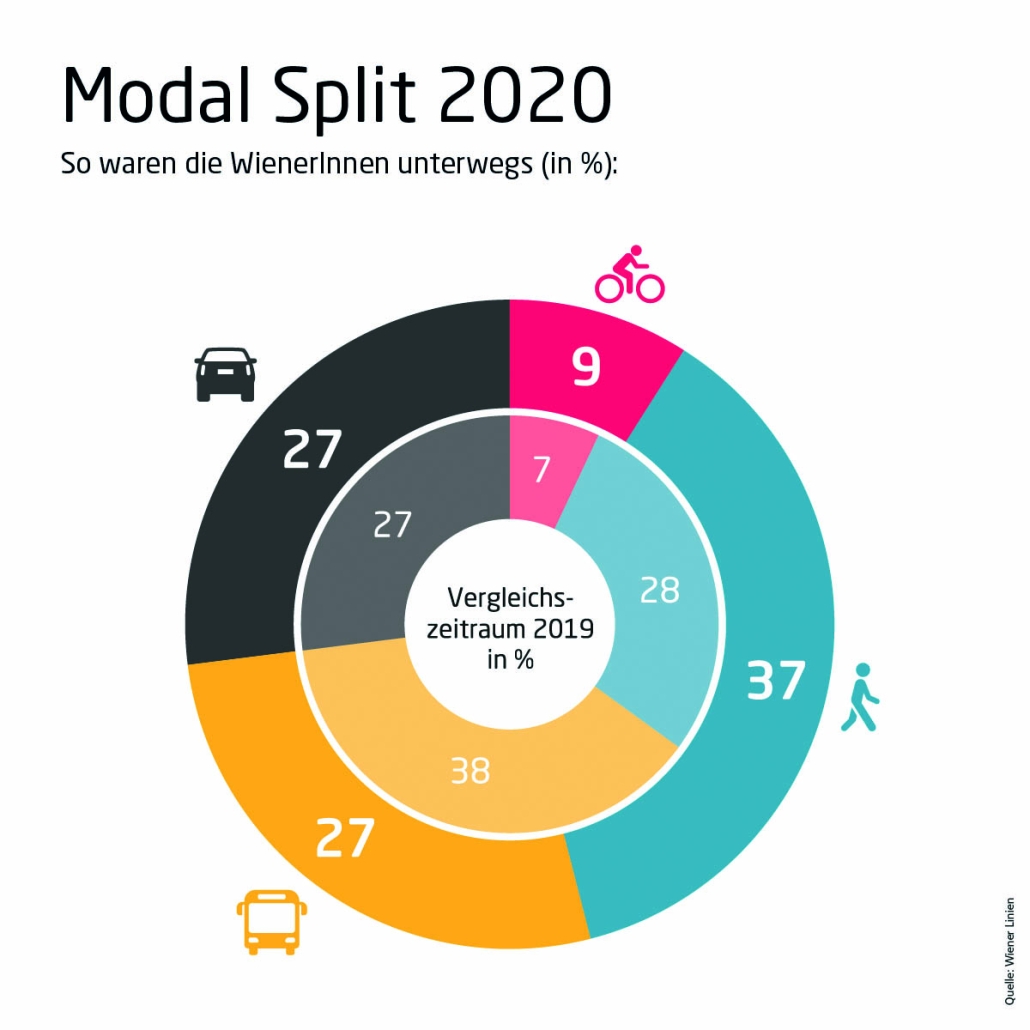









 Dutch Cycle Embassy
Dutch Cycle Embassy
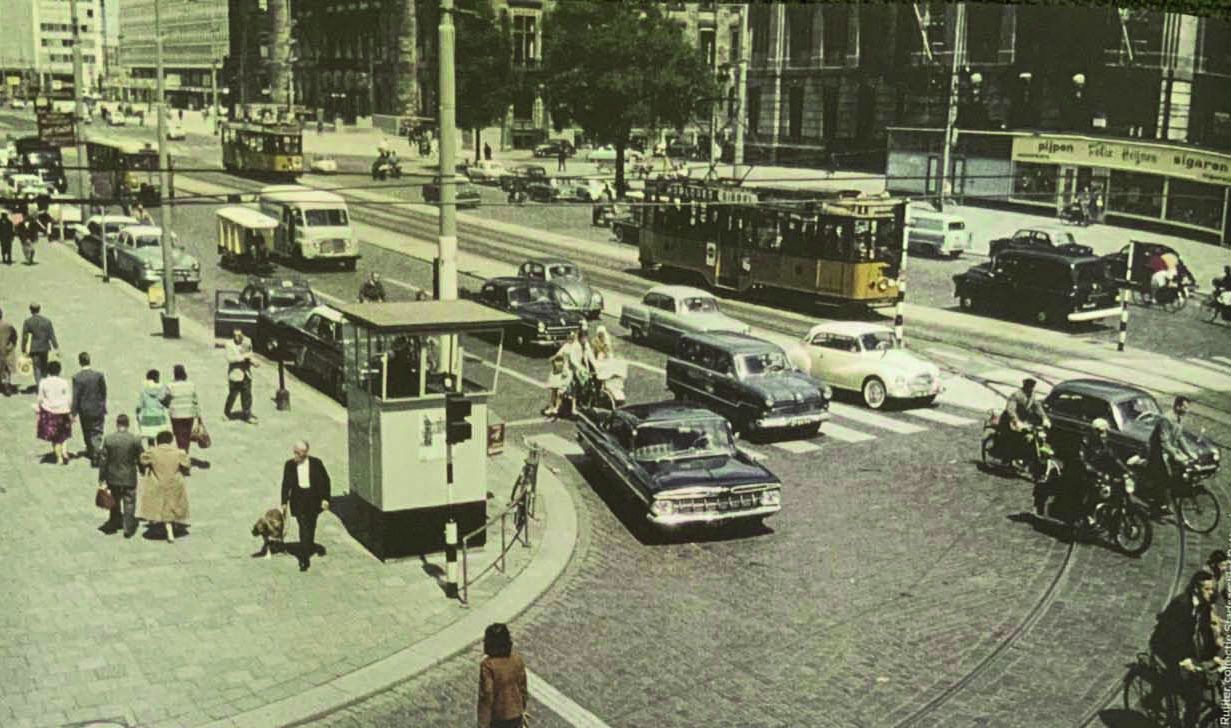


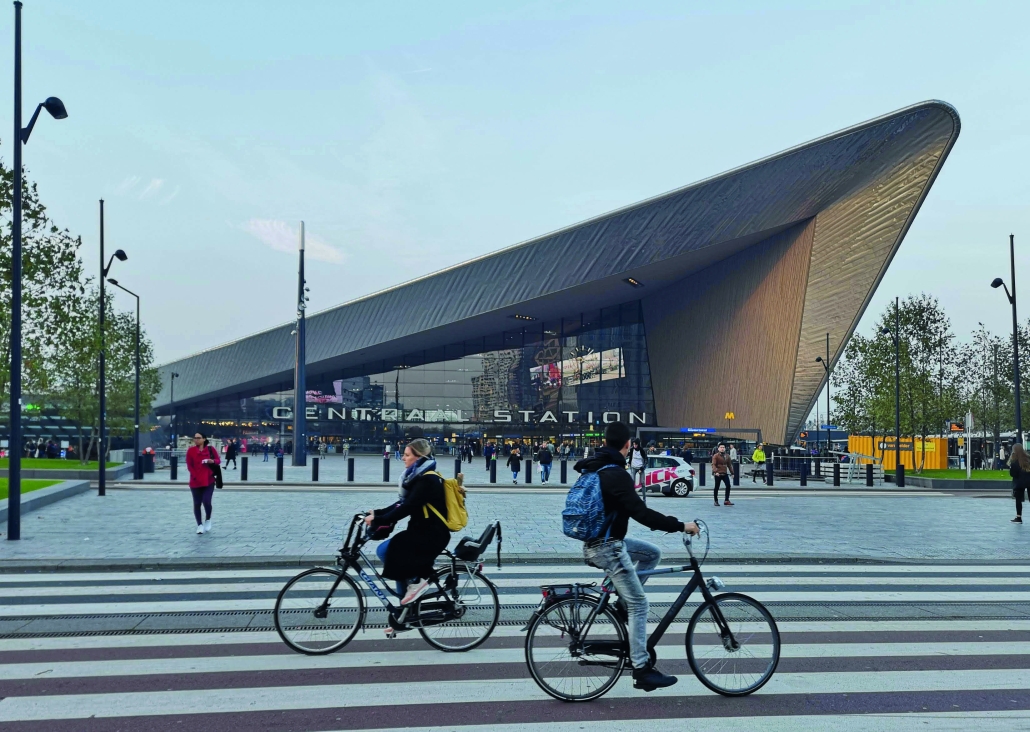





 Orion Bausysteme, Nikolay Kazakov
Orion Bausysteme, Nikolay Kazakov


 M. Zapf - MRH
M. Zapf - MRH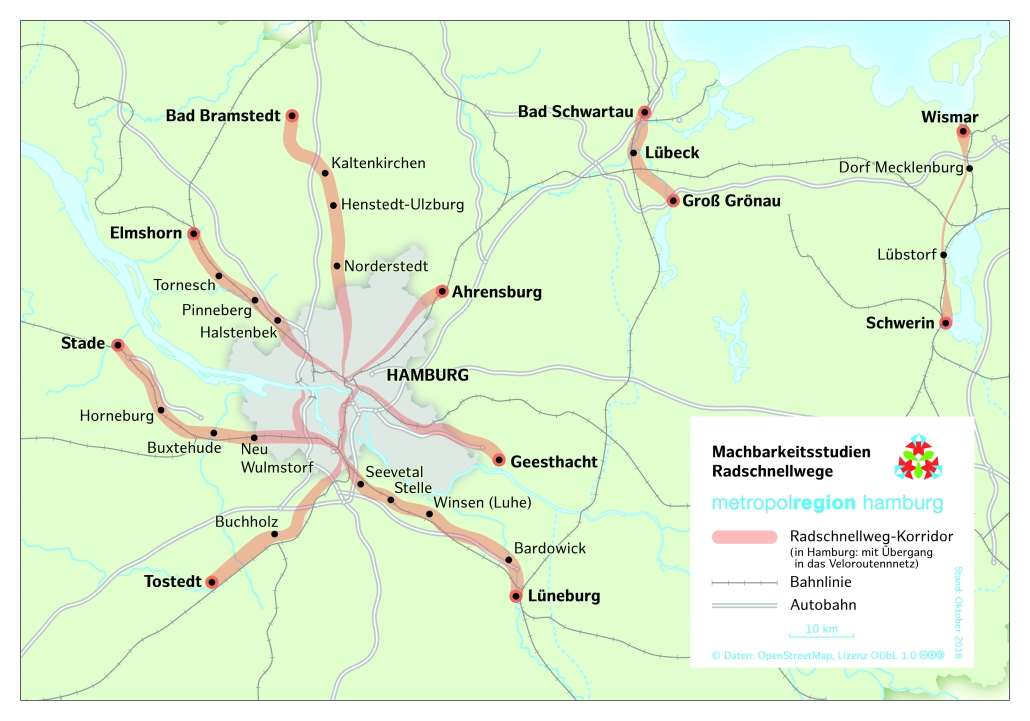

 BMVI - Peter Adamik
BMVI - Peter Adamik



 stock.adobe.com - Katja Xenikis
stock.adobe.com - Katja Xenikis




 Hector Hoogstad Architecten / Petra Appelhof
Hector Hoogstad Architecten / Petra Appelhof




 Infravelo
Infravelo









